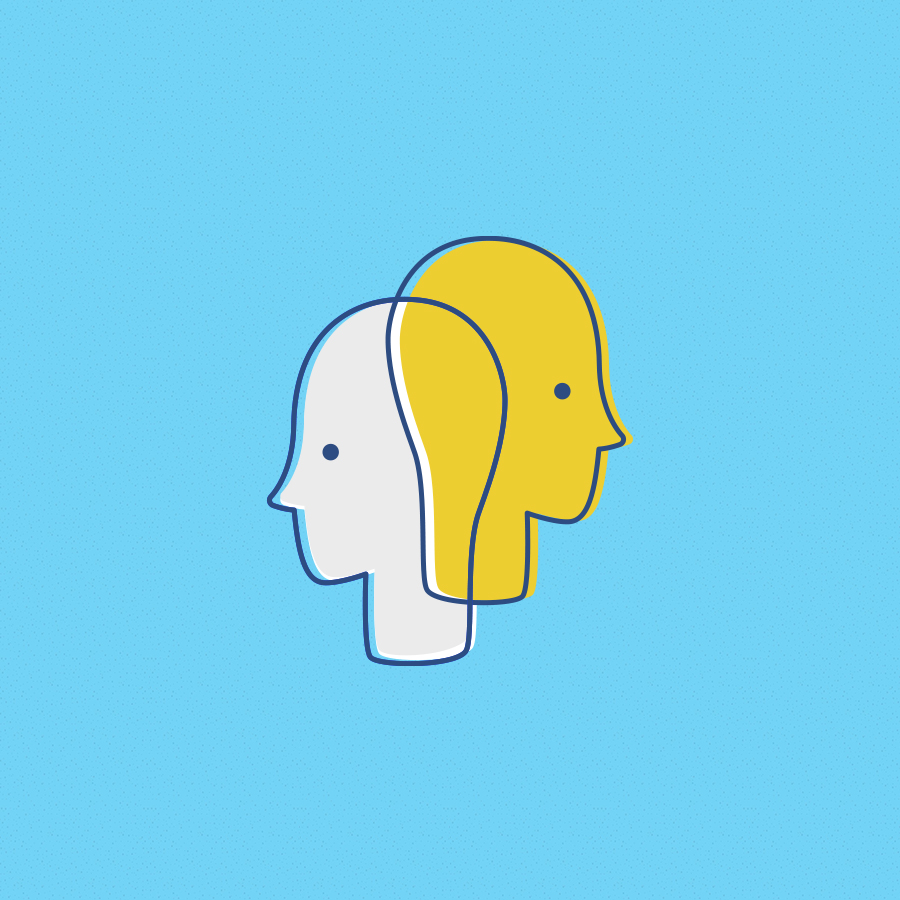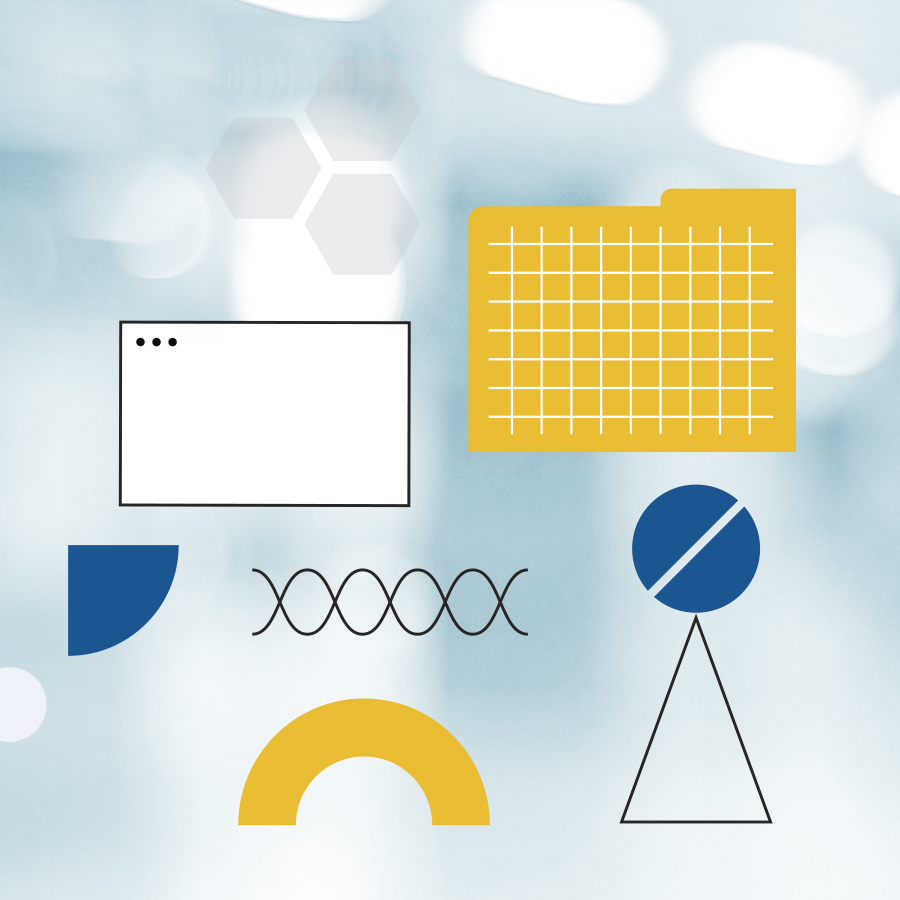-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Expertise
Publication
60, 30, 15, … 7.5? What History Suggests About Generative AI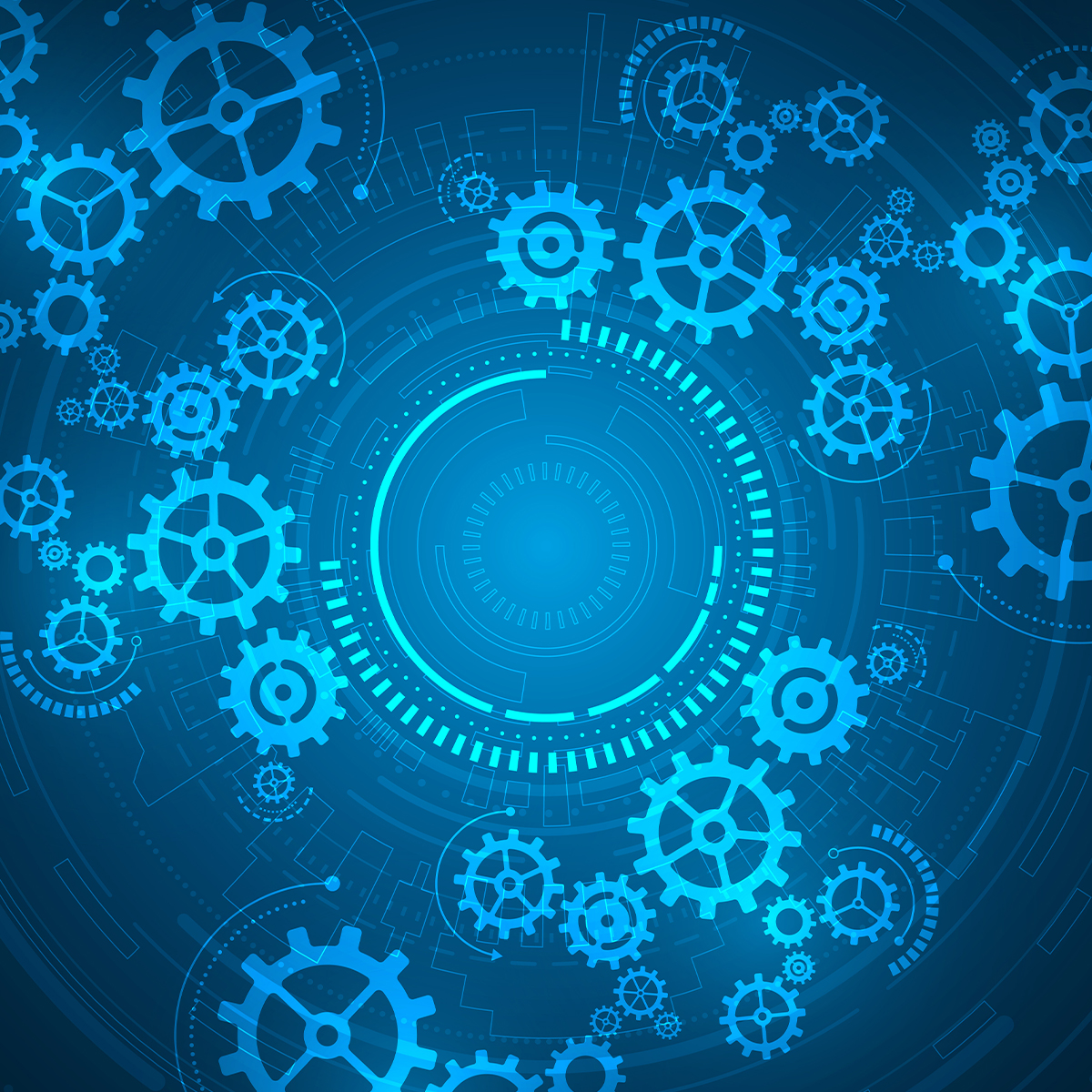
Publication
AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows
Publication
Creating Strong Reinsurance Submissions That Drive Better Outcomes
Publication
Is Human Trafficking the Next Big Liability Exposure for Insurers?
Publication
Engineered Stone – A Real Emergence of Silicosis -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
Gen Re’s valuable insights and risk transfer solutions help clients improve their business results. With tailor-made reinsurance programs, clients can achieve their life & health risk management objectives.
UnderwritingTraining & Education
Publication
Diabetes and Critical Illness Insurance – Bridging the Protection Gap
Publication
Underwriting the Dead? How Smartphones Will Change Outcomes After Sudden Cardiac Arrest
Publication
Always On: Understanding New Age Addictions and Their Implications for Disability Insurance
Publication
Dying Gracefully – Legal, Ethical, and Insurance Perspectives on Medical Assistance in Dying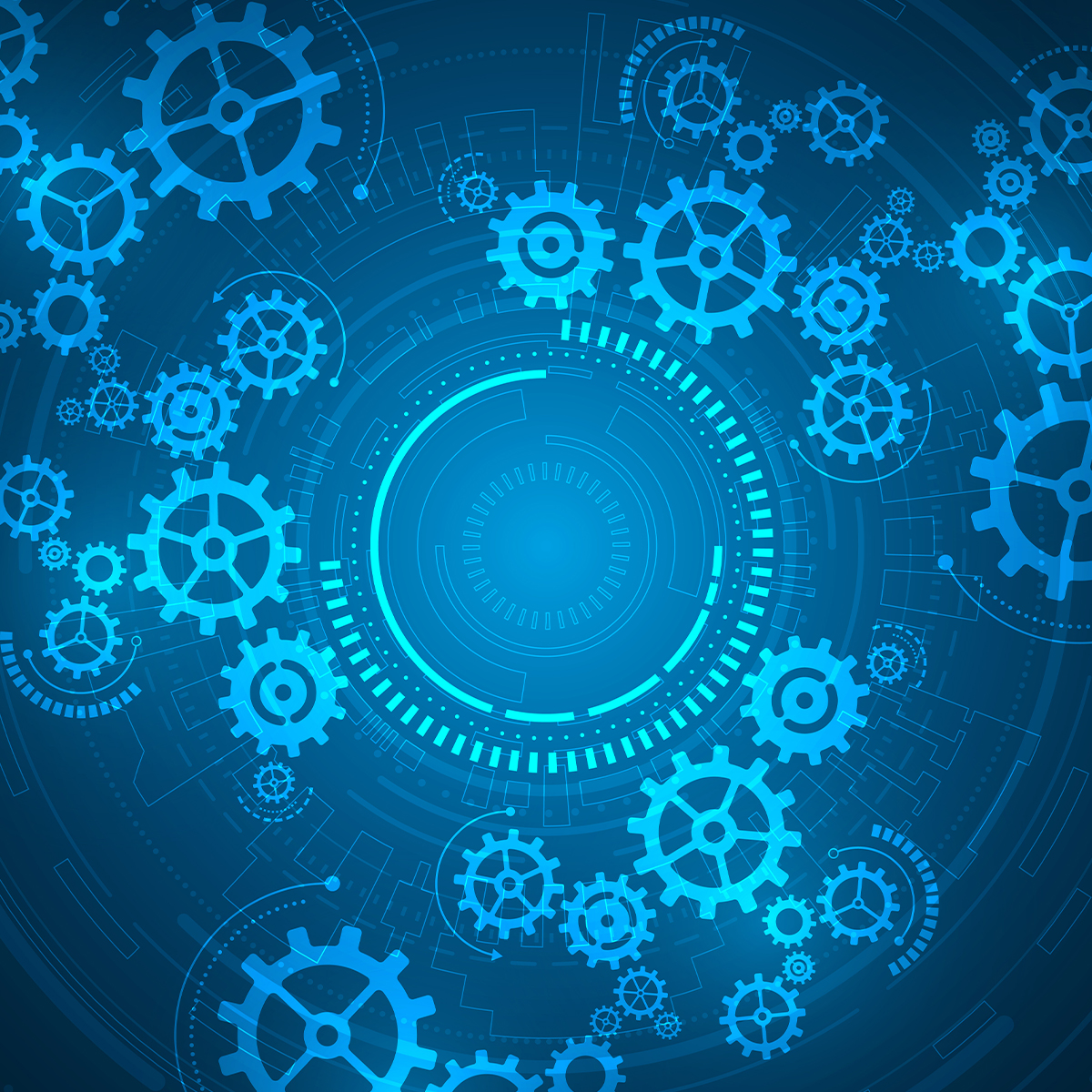
Publication
AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows Business School
Business School -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview
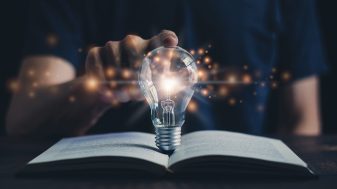
Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
Generative künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf das Wetter- und Klimarisikomanagement in der Versicherungsbranche

September 15, 2025
Frank Schmid
Deutsch
English
Wetter- und Klimagefahren gehören nach wie vor zu den größten Unsicherheitsfaktoren für Versicherer und Rückversicherer und beeinflussen die Schadenentwicklung in den Sparten Sach‑, Agrar‑, Transport‑, Energie- sowie den entsprechenden Betriebsunterbrechungsversicherungen. Tropische Wirbelstürme, Überschwemmungen, Hagel, Dürren und Waldbrände verursachen sowohl häufige schleichende Schäden als auch seltene, schwere Extremereignisse, die das Kapital belasten, Katastrophenmodelle auf die Probe stellen und die Angemessenheit von Rückversicherungsdeckungen auf den Prüfstand stellen. In diesem Umfeld sind die Genauigkeit, Aktualität und probabilistische Qualität von Prognosen nicht nur wissenschaftliche Belange, sondern operative Inputs für die Auswahl von Versicherungsverträgen, das Schadenspitzen-Management, die Strukturierung von Rückversicherungen und die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen.
Von physikalisch basierter numerischer Wettervorhersage zu generativer KI
Die Branche stützt sich seit langem auf numerische Wettervorhersagen (NPW), die die maßgeblichen Gleichungen der Atmosphärenbewegung und Thermodynamik in Rechenrastern integrieren. Die Güte der Vorhersagen hat sich deutlich verbessert, doch praktische Einschränkungen bestehen weiterhin. Hochauflösende deterministische Läufe und große Ensembles sind teuer und langsam, und die Latenzzeit von der Initialisierung bis zur Produktlieferung kann die Geschwindigkeit einschränken, mit der Risiken, Personal und Absicherungen an sich schnell verändernde Ereignisse angepasst werden können. Der Mehrwert von Ensembles – die Quantifizierung von Verteilungen und Ausreißern anstelle einer einzelnen Trajektorie – kollidiert oft mit Rechenbudgets und operativen Fristen.
Generative KI bezieht sich hier auf Modelle, die auf großen Archiven von Wetterdaten – insbesondere Reanalysen und in einigen Fällen auch operativen Analysen1 – trainiert wurden und lernen, wie sich atmosphärische Variablen gemeinsam entwickeln. Zur Laufzeit leiten sie aus diesen gelernten Beziehungen zukünftige Zustände ab, anstatt den gesamten Satz physikalischer Gleichungen numerisch zu lösen. Dies ermöglicht präzise Vorhersagen innerhalb von Minuten bei deutlich geringeren Rechenkosten und in einer für den praktischen Einsatz geeigneten Auflösung. Reanalyse-Datensätze – wie ERA5, zusammengestellt vom Copernicus Climate Change Service (C3S) am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF) – liefern jahrzehntelange, global konsistente Felder, die die Modelle in ihrer Variabilität über verschiedene Skalen hinweg, einschließlich Extremereignissen, verankern.2
Stand der Technik
Zu den einflussreichsten Systemen gehört GraphCast von Google DeepMind.3 Es stellt die Atmosphäre auf einem sphärischen Graphen dar, überträgt Informationen zwischen Knoten, um multiskalige Wechselwirkungen zu erfassen, und läuft autoregressiv in Sechs-Stunden-Schritten, um Prognosen für bis zu zehn Tage zu erstellen. Eine von Fachkollegen begutachtete Studie in Science berichtete, dass GraphCast das hochauflösende deterministische Modell (HRES) des ECMWF bei etwa 90 Prozent von 1.380 Verifizierungszielen übertraf und dabei Prognosen mit sehr geringer Latenz lieferte.4 Für Versicherer ermöglicht dies schnelle, hochqualifizierte deterministische Leitlinien zu Wind, Niederschlag und Temperatur – Parameter, die direkt in die Schätzung von Sturmschäden, die Triage von Hochwasserschäden und die operative Echtzeitüberwachung während aktiver Ereignisse einfließen.
Die probabilistische Modellierung hat sich ebenso schnell weiterentwickelt. GenCast5 von DeepMind erweitert dieses Paradigma auf Ensembles unter Verwendung diffusionsbasierter generativer Modellierung. In den 2025 in Nature veröffentlichten Ergebnissen erstellte GenCast globale 15‑Tage-Ensembles mit einer Auflösung von 0,25° und 12‑Stunden-Zeitschritten in etwa acht Minuten und übertraf damit die Leistungsfähigkeit des ENS – des operativen Ensemble-Systems des ECMWF – bei den meisten bewerteten Zielen.6 Da Schadenquoten und Kapitalkosten häufig eher durch Extremwerte als durch Mittelwerte bestimmt werden, verbessern häufige, kostengünstige Ensemble-Aktualisierungen die Quantifizierung von Extremwerten erheblich und erleichtern die Neukalibrierung parametrischer Trigger, die Überarbeitung von Ereignisreaktions-Footprints und eine präzisere Rückstellung im Verlauf einer Katastrophe.
Ein breiteres Ökosystem treibt die Entwicklung in diesem Bereich voran. Das 2023 in Nature veröffentlichte Pangu-Weather von Huawei demonstrierte eine wettbewerbsfähige mittelfristige Leistungsfähigkeit bei deutlich geringeren Rechenkosten,7 was dort von Bedeutung ist, wo der Zugang zu Hochleistungsrechnern eingeschränkt ist. Die FourCastNet-Familie von NVIDIA kombiniert zusammen mit der Earth‑2-Plattform Fourier-Operatoren8 und Transformer-Architekturen mit GPU (Graphics Processing Unit) - Beschleunigung, um schnelle globale Vorhersagen zu liefern und sehr große Ensembles zu unterstützen.9 Generative KI hält auch durch hybride Systeme wie NeuralGCM Einzug in die Klimamodellierung.10 Diese Modelle behalten einen physikalischen Kern bei und verwenden maschinelles Lernen, um Prozesse darzustellen, die sich nur schwer direkt lösen lassen. Sie sind so konzipiert, dass sie von täglichen Wettervorhersagen bis hin zu Simulationen über mehrere Jahrzehnte hinweg stabil bleiben und auf ein einziges Rahmenwerk abstellen, das kurzfristige Gefahrenprognosen mit langfristigen Klimarisikoprognosen verknüpft.
Microsofts Aurora ergänzt diesen Ansatz um ein Fundament-Modell: eine 3D‑Architektur mit rund 1,3 Milliarden Parametern, die auf mehr als einer Million Stunden heterogener Erddatensätze vortrainiert und anschließend für Aufgaben wie hochauflösende Wettervorhersagen, Luftqualität, Meereswellen und tropische Wirbelstürme durch Fine-Tuning optimiert wurde. Peer-Review- und technische Materialien berichten, dass Aurora die operativen Basiswerte für diese Aufgaben bei um ein Vielfaches geringeren Rechenkosten erreicht oder übertrifft und mit moderner GPU-Beschleunigung hochauflösende Zehn-Tage-Prognosen in weniger als einer Minute erstellt.11
Operative Validierung
Die vielleicht bedeutendste Bestätigung kam vom ECMWF. Am 25. Februar 2025 nahm das Zentrum sein Artificial Intelligence Forecasting System (AIFS) für deterministische Vorhersagen in Betrieb, das parallel zum traditionellen physikalisch basierten Integrated Forecasting System (IFS) läuft.12 Am 1. Juli 2025 nahm das ECMWF die Ensemble-Version des AIFS in Betrieb und liefert Produkte über seine Standard-Verbreitungs- und Open-Data-Kanäle.13 Erste Überprüfungen ergaben eine Gleichwertigkeit oder Überlegenheit gegenüber herkömmlichen Modellen bei wichtigen Kennzahlen, darunter gemeldete Verbesserungen von bis zu etwa 20 Prozent bei der Vorhersage der Zugbahnen tropischer Wirbelstürme.14 Für Versicherer mit Risiken an Küsten bedeutet die verbesserte Vorhersage der Zugbahnen eine zuverlässigere Vorbereitung auf Sturmfluten, genauere Angaben zum Ausmaß der Ereignisse und genauere vorläufige Schadensschätzungen. KI‑Prognosen fließen nun in die operativen und offenen Datenströme des ECMWF ein – dieselben Kanäle, die auch von Modellierungs- und Analyse-Workflows von Drittanbietern weit verbreitet genutzt werden.15
Drei Ansätze für Wetter- und Klimaprognosen
Numerische Wettervorhersage (NWP) – NWP verwendet physikalisch basierte Computermodelle, um die Atmosphäre zu simulieren und die Bedingungen zeitlich fortzuschreiben. Ihre Stärken liegen in ihrer wissenschaftlichen Grundlage, ausgereiften Verfahren zur Erfassung und Assimilation von Beobachtungen und jahrzehntelanger systematischer Verifizierung. Zu den Einschränkungen zählen der erhebliche Rechenaufwand und die langsamere Bearbeitungszeit, was die Aktualisierungshäufigkeit und die räumliche Auflösung einschränken kann. Die Prognosegenauigkeit ist in der Regel im nahen bis mittleren Bereich – von Stunden bis zu etwa zehn Tagen – am höchsten, wobei die Leistung je nach Region, Jahreszeit und Wetterlage variiert.
Ensemble-Modelle – Ensemble-Vorhersagen generieren viele plausible Versionen einer Vorhersage, indem sie die Ausgangsbedingungen verändern, die Modelleinstellungen variieren oder verschiedene Modellierungssysteme, darunter auch moderne KI‑Modelle, kombinieren. Anstelle einer einzigen Antwort liefern Ensembles eine Verteilung von Ergebnissen mit den dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten, was klarere Aussagen über Unsicherheiten und Extreme ermöglicht. Um zuverlässig zu bleiben, sollten Ensembles kalibriert und auf Verzerrungen korrigiert werden, damit ihre Streuung die beobachtete Unsicherheit widerspiegelt. Praktische Überlegungen umfassen größere Datenmengen, kontinuierliche Qualitätskontrolle und eine klare Kommunikation der probabilistischen Ergebnisse.
Differenzierbare allgemeine Zirkulationsmodelle (differentiable General Circulation Models – dGCMs) – dGCMs kombinieren einen traditionellen physikalischen Kern mit Komponenten des maschinellen Lernens in einem Rahmenwerk, das mithilfe von Daten direkter angepasst werden kann. Ziel ist es, die physikalische Struktur zu erhalten und gleichzeitig Elemente zu verbessern, die sich nur schwer explizit darstellen lassen. Grundsätzlich unterstützt dies eine konsistente Leistung von der täglichen Wettervorhersage bis hin zu Klimasimulationen über mehrere Jahrzehnte. Zu den aktuellen Prioritäten gehören der Nachweis der Zuverlässigkeit bei Extremereignissen, die Begrenzung langsamer Drifts über lange Laufzeiten, die Steuerung regionaler Verzerrungen und die Wahrung der Transparenz hinsichtlich des Verhaltens der gelernten Komponenten.
Auswirkungen, Einführung und Integration
Die Auswirkungen auf das Versicherungsgeschäft, die Rückversicherung und das Kapital sind unmittelbar. Schnellere und kostengünstigere Ensembles ermöglichen eine häufigere Schadenanalyse während Ereignissen, sodass in der Schadenvorsorge Ressourcen vorab positioniert und mit besserer Vorlaufzeit vorübergehende Unterkünfte und Reparaturkapazitäten sichern können. Underwriter können räumliche Risikobewertungen innerhalb eines Tages aktualisieren, wenn sich eine Zugbahn oder ein Niederschlagsbereich verschiebt, wodurch das Expositionsmanagement verbessert und Echtzeitanpassungen der Zeichnungsbefugnisse oder Aggregationsobergrenzen ermöglicht werden.
Rückversicherungsteams können Szenariobäume mit wesentlich größeren Stichproben erstellen und so die Layer-Attachments und Wiederauffüllungsgsstrukturen verfeinern, wenn die Unsicherheit abnimmt. Die Kapitalmodellierung profitiert von einer besseren Charakterisierung der Verteilungsenden unter den Solvency II16- und NAIC RBC17-Regelungen, insbesondere wenn Ereignissätze neu stichprobenartig ausgewählt oder anhand aktualisierter dynamischer Leitlinien angepasst werden. In Kombination mit gut kalibrierten Vulnerabilitäts- und Finanzmodulen führen Verbesserungen auf der Prognoseebene zu stabileren PMLs (Probable Maximum Loss), engeren AAL-Konfidenzintervallen (Average Annual Loss) und präziseren Interimsbrandbreiten für Vorstände, Investoren und Aufsichtsbehörden.
Die Einführung erfordert Sorgfalt. Unabhängige Bewertungen zeigen, dass KI‑Wettervorhersagemodelle zwar mittlerweile mit den besten physikalischen Systemen bei der Vorhersage tropischer Wirbelstürme mithalten oder diese sogar übertreffen, die Intensität – insbesondere in den ersten 24 Stunden und bei rascher Intensivierung – jedoch nach wie vor eine Herausforderung darstellt, mit einer Tendenz zur Unterschätzung, die auf Trainingsdaten und Auflösungsgrenzen zurückzuführen sein kann.18 ECMWF-Unterlagen zu AIFS weisen ebenso darauf hin, dass kleinräumige Strukturen geglättet werden können und dass die Behandlung von Verzerrungen bei Niederschlägen und anderen Feldern weiterhin ein aktiver Entwicklungsbereich ist.19 Bevor Modellausgaben als Grundlage für finanzielle Entscheidungen mit hohem Risiko herangezogen werden, sollten eine Kalibrierung anhand der lokalen Klimatologie, eine kontextbewusste Nachbearbeitung und eine modellübergreifende Zusammenführung durchgeführt und die Ergebnisse anhand einheitlicher Verifizierungsstandards dokumentiert werden.
Bei der Integration sollten End-to-End-Konsistenz und geringe Latenzzeiten im Vordergrund stehen. Meteorologische Felder sollten mit derselben Auflösung wie die Geokodierung der Exposition in Gefahrenflächen umgewandelt und dann mit aktuellen Vulnerabilitätskurven und Vertragsbedingungen verknüpft werden. Da moderne KI‑Systeme Ensembles mehrmals täglich aktualisieren können, ist eine streambasierte Assimilation in Live-Katastrophenansichten einer einmal täglichen Batch-Aktualisierung vorzuziehen. Die Datenverwaltung verdient ebenso viel Aufmerksamkeit: Eine Dokumentation der Modellrisiken – mit Angaben zu Versionen, Trainingsdaten und Nachbearbeitungsoptionen zur Überprüfbarkeit – sollte geführt werden; zudem sollten klare Verfahren für das Änderungsmanagement festgelegt werden. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Verbesserung der Prognose mit minimaler Verzögerung und ohne Verlust an Genauigkeit in die Portfoliokennzahlen und Kapitalberechnungen einfließen.
Ausblick
Generative KI wird die Physik nicht über Nacht verdrängen. Physikbasierte Systeme bleiben für die Datenassimilation, Out-of-Distribution-Szenarien und physikalisch fundierte Validierungen unverzichtbar. Was sich ändert, sind die Wirtschaftlichkeit und der Rhythmus von Prognosen: Datengesteuerte Modelle bieten geringere Latenzzeiten und Kosten bei nützlichen Auflösungen, wodurch häufige Aktualisierungen und große Ensembles im täglichen Betrieb möglich werden.
Der effektivste Weg in die Zukunft ist die komplementäre Nutzung. Die Physik verankert Prognosen in Erhaltungssätzen und langen Verifizierungsaufzeichnungen, während KI schnelle Emulation, Verzerrungskorrektur, Downscaling und große probabilistische Stichproben liefert. In der Praxis bedeutet dies eine KI‑Nachbearbeitung deterministischer Ergebnisse, KI‑basierte Ensemble-Perturbationen, gelernte Parametrisierungen innerhalb physikalischer Modelle und gezielte Surrogate für die aufwendigsten Rechenschritte. Der Fortschritt sollte durch disziplinierte Verifizierung und klare Governance gesteuert werden.
Deterministische und probabilistische Güte sollte anhand etablierter Kennzahlen überwacht, Modelle und Datensätze versioniert und bekannte Verzerrungen sowie Kalibrierungsverfahren dokumentiert werden. Das Ergebnis ist ein breiteres, schnelleres Toolkit – reichhaltigere probabilistische Leitlinien, die über Wetter- und Klimahorizonte hinweg verknüpft sind – das mit transparenter Kalibrierung und Überwachung eingesetzt wird.
- Reanalysen sind retrospektive Rekonstruktionen vergangener Wetterereignisse, die mit einem einzigen, festen Modell und einem Assimilationssystem erstellt werden, das konsistent auf das gesamte historische Archiv angewendet wird (oft einschließlich Beobachtungen, die nicht in Echtzeit verfügbar sind). Sie zielen eher auf zeitliche Homogenität und Stabilität als auf Unmittelbarkeit ab; die Latenzzeit beträgt Wochen bis Monate. Operative Analysen sind die in Echtzeit erstellten „besten Schätzungen” der atmosphärischen Zustände, die vom Datenassimilationszyklus einer Vorhersagezentrale zur Initialisierung der heutigen Vorhersagen erstellt werden. Das Modell und das Assimilationssystem werden regelmäßig aktualisiert, sodass die Aufzeichnungen im Zeitverlauf nicht einheitlich sind; die Latenzzeit beträgt Stunden.
- Siehe Hans Hersbach und Dick Dee, „ERA5 reanalysis is in production“, ECMWF Newsletter Nr. 147, Frühjahr 2016, https://www.ecmwf.int/en/newsletter/147/news/era5-reanalysis-production.
- Siehe Remi Lam, „GraphCast: AI model for faster and more accurate global weather forecasting“, Google Deep Mind, 14. November 2023, https://deepmind.google/discover/blog/graphcast-ai-model-for-faster-and-more-accurate-global-weather-forecasting/.
- Siehe Remi Lam, Alvaro Sanchez-Gonzalez, Matthew Willson, Peter Wirnsberger, Meire Fortunato, Ferran Alet, Suman Ravuri, Timo Ewalds, Zach Eaton-Rosen, Weihua Hu, Alexander Merose, Stephan Hoyer, George Holland, Oriol Vinyals, Jacklynn Stott, Alexander Pritzel, Shakir Mohamed und Peter Battaglia, „Learning skillful medium-range global weather forecasting“, Science Band 382, Nr. 6677, 14. November 2023, https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi2336.
- Siehe Ilan Price und Matthew Wilson, „GenCast predicts weather and the risks of extreme conditions with state-of-the-art accuracy“, Google Deep Mind, 4. Dezember 2024, https://deepmind.google/discover/blog/gencast-predicts-weather-and-the-risks-of-extreme-conditions-with-sota-accuracy/. Die technische Abhandlung finden Sie unter Ilan Price, Alvaro Sanchez-Gonzalez, Ferran Alet, Tom R. Andersson, Andrew El‑Kadi, Dominic Masters, Timo Ewalds, Jacklynn Stott, Shakir Mohamed, Peter Battaglia, Remi Lam und Matthew Willson, „GenCast: Diffusion-based ensemble forecasting for medium-range weather“, zuletzt überarbeitet am 1. Mai 2024, https://arxiv.org/abs/2312.15796.
- Siehe Ilan Price, Alvaro Sanchez-Gonzalez, Ferran Alet, Tom R. Andersson, Andrew El‑Kadi, Dominic Masters, Timo Ewalds, Jacklynn Stott, Shakir Mohamed, Peter Battaglia, Remi Lam und Matthew Willson, „Probabilistic weather forecasting with machine learning“, Nature Band 637, 84‑90, 2025, https://www.nature.com/articles/s41586-024-08252-9.
- Siehe Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Hengheng Zhang, Xin Chen, Xiaotao Gu und Qi Tian, „Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks“, Nature Band 619, 533‑538, 2023, https://www.nature.com/articles/s41586-023-06185-3 und „Author Correction: Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks“, Nature Band 621, E45, 2023, https://www.nature.com/articles/s41586-023-06545-z.
- Ein adaptiver Fourier-Neuraloperator (AFNO) ist eine Art neuronaler Netzwerkarchitektur, die komplexe Muster durch Umwandlung von Daten in Frequenzen effizient lernen kann und sich daher für die Modellierung komplexer räumlicher oder zeitlicher Beziehungen in der Wettervorhersage eignet.
- Siehe Jaideep Pathak, Shashank Subramanian, Peter Harrington, Sanjeev Raja, Ashesh Chattopadhyay, Morteza Mardani, Thorsten Kurth, David Hall, Zongyi Li, Kamyar Azizzadenesheli, Pedram Hassanzadeh, Karthik Kashinath und Animashree Anandkumar, „FourCastNet: A Global Data-driven High-resolution Weather Model using Adaptive Fourier Neural Operators“, eingereicht am 22. Februar 2022, https://arxiv.org/abs/2202.11214.
- Siehe Stephan Hoyer, „Fast, accurate climate modeling with NeuralGCM“, Google Research Blog, 22. Juli 2024, https://research.google/blog/fast-accurate-climate-modeling-with-neuralgcm/. Weitere Informationen finden Sie bei Dmitrii Kochkov, Janni Yuval, Ian Langmore, Peter Norgaard, Jamie Smith, Griffin Mooers, Milan Klöwer, James Lottes, Stephan Rasp, Peter Düben, Sam Hatfield, Peter Battaglia, Alvaro Sanchez-Gonzalez, Matthew Willson, Michael P. Brenner und Stephan Hoyer, „Neural general circulation models for weather and climate“, Nature Band 632, 1060‑1066, 2024, https://www.nature.com/articles/s41586-024-07744-y.
- Siehe Wessel Bruinsma, Megan Stanley, Ana Lucic, Richard Turner und Paris Perdikaris, „Introducing Aurora: The first large-scale foundation model of the atmosphere“, Microsoft Research Blog, 3. Juni 2024, https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/introducing-aurora-the-first-large-scale-foundation-model-of-the-atmosphere/. Weitere Informationen finden Sie bei Cristian Bodnar, Wessel P. Bruinsma, Ana Lucic, Megan Stanley, Anna Allen, Johannes Brandstetter, Patrick Garvan, Maik Riechert, Jonathan A. Weyn, Haiyu Dong, Jayesh K. Gupta, Kit Thambiratnam, Alexander T. Archibald, Chun-Chieh Wu, Elizabeth Heider, Max Welling, Richard E. Turner und Paris Perdikaris, „A foundation model for the Earth system“, Nature Band 641, 1180‑1187, 2025, https://www.nature.com/articles/s41586-025-09005-y.
- Siehe ECMWF, ECMWF’s AI forecasts become operational, 25. Februar 2025. https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2025/ecmwfs-ai-forecasts-become-operational.
- Siehe ECMWF, ECMWF’s ensemble AI forecasts become operational, 1. Juli 2025, https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2025/ecmwfs-ensemble-ai-forecasts-become-operational.
- Siehe ECMWF, ECMWF’s AI forecasts become operational, op.cit.
- Siehe ECMWF, Datasets: Open Data, https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/open-data.
- Siehe European Insurance and Occupational Pensions Authority, Directive 138/2009/EC (Solvency II Directive), https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii-single-rulebook/directive-1382009ec-solvency-ii-directive_en.
- Siehe National Association of Insurance Commissioners, Risk-Based Capital (RBC) for Insurers Model Act, Januar 2012, https://content.naic.org/sites/default/files/model-law-312.pdf.
- Siehe Mark DeMaria, James L. Franklin, Galina Chirokova, Jacob Radford, Robert DeMaria, Kate D. Musgrave und Imme Ebert-Uphoff, „Evaluation of Tropical Cyclone Track and Intensity Forecasts from Artificial Intelligence Weather Prediction (AIWP) Models“, eingereicht am 8. September 2024, https://arxiv.org/abs/2409.06735.
- Siehe ECMWF, Implementation of AIFS Single v1, https://confluence.ecmwf.int/display/FCST/Implementation%2Bof%2BAIFS%2BSingle%2Bv1, zuletzt geändert am 1. August 2025.