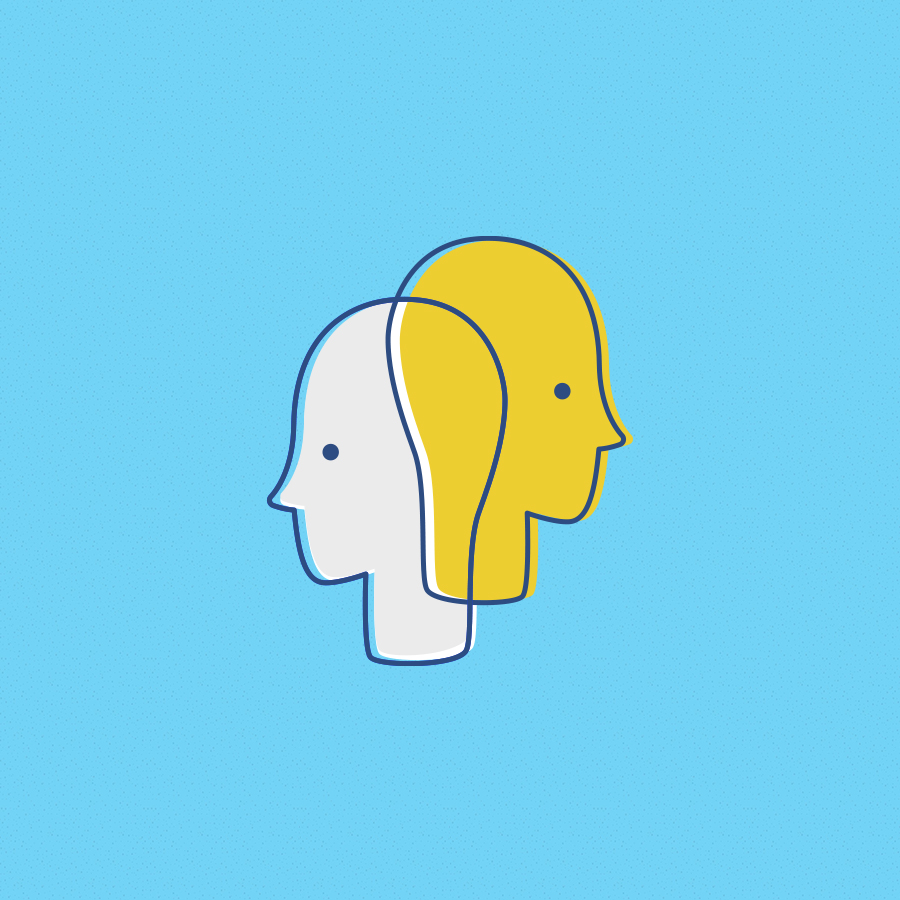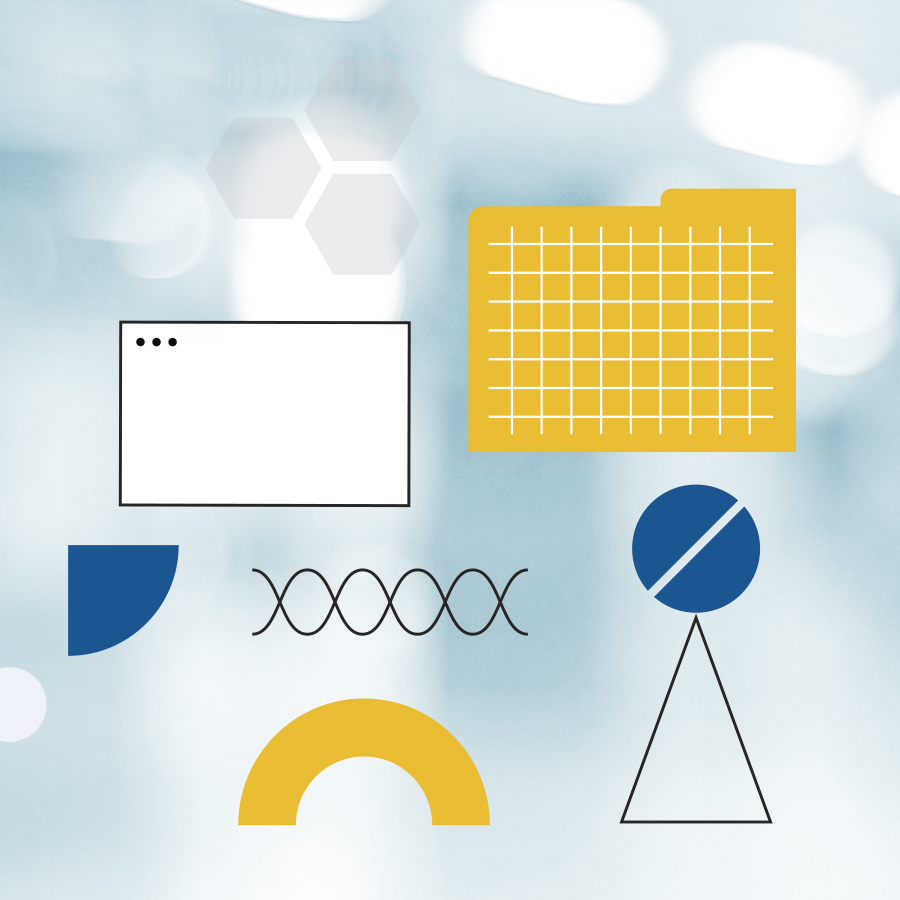-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Trending Topics
Publication
60, 30, 15, … 7.5? What History Suggests About Generative AI
Publication
Creating Strong Reinsurance Submissions That Drive Better Outcomes
Publication
Florida Property Tort Reforms – Evolving Conditions
Publication
Is Human Trafficking the Next Big Liability Exposure for Insurers?
Publication
Generative Artificial Intelligence and Its Implications for Weather and Climate Risk Management in Insurance -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Training & Education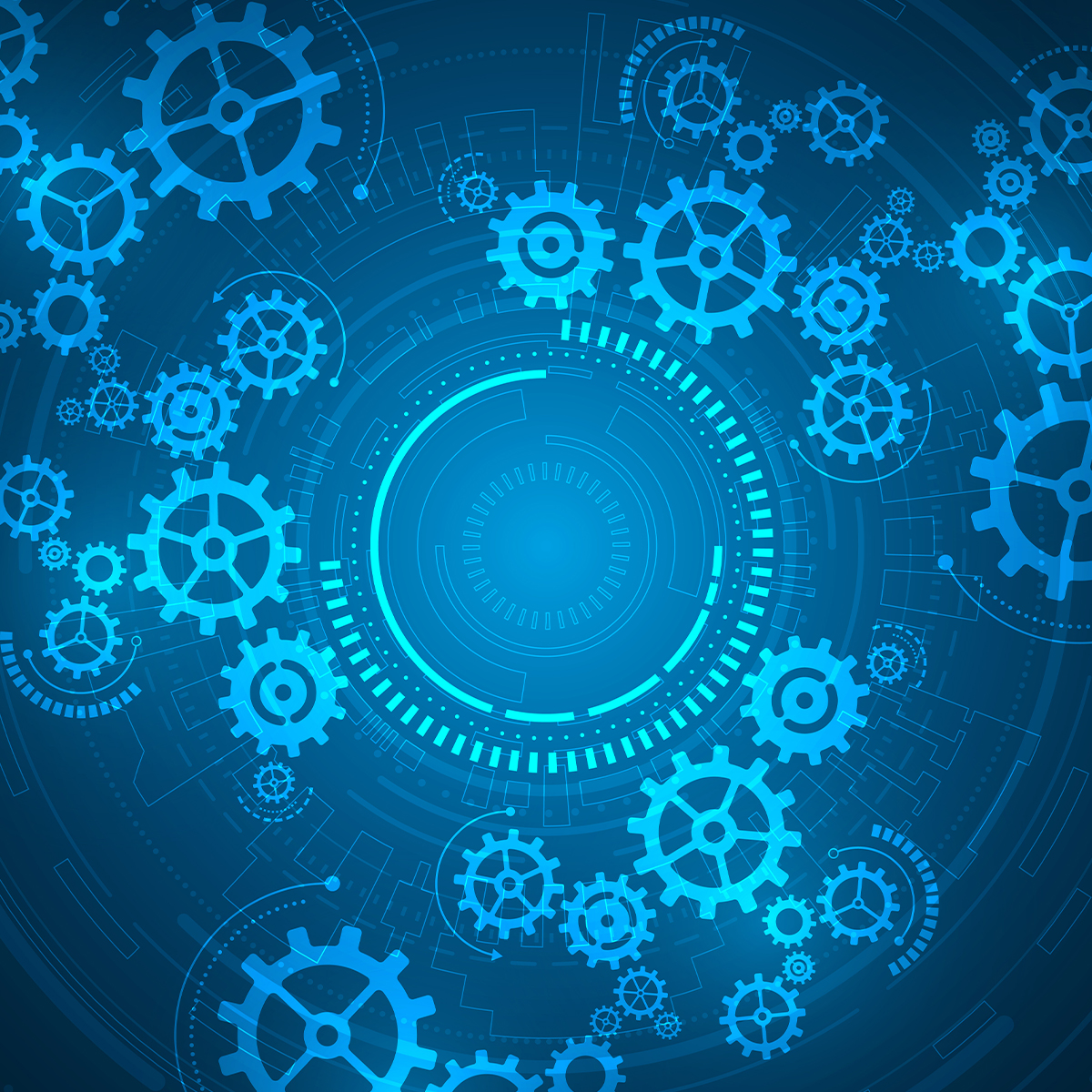
Publication
AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows
Publication
Diabetes and Critical Illness Insurance – Bridging the Protection Gap
Publication
Group Medical EOI Underwriting – Snapshot of U.S. Benchmark Survey
Publication
Why HIV Progress Matters
Publication
Dying Gracefully – Legal, Ethical, and Insurance Perspectives on Medical Assistance in Dying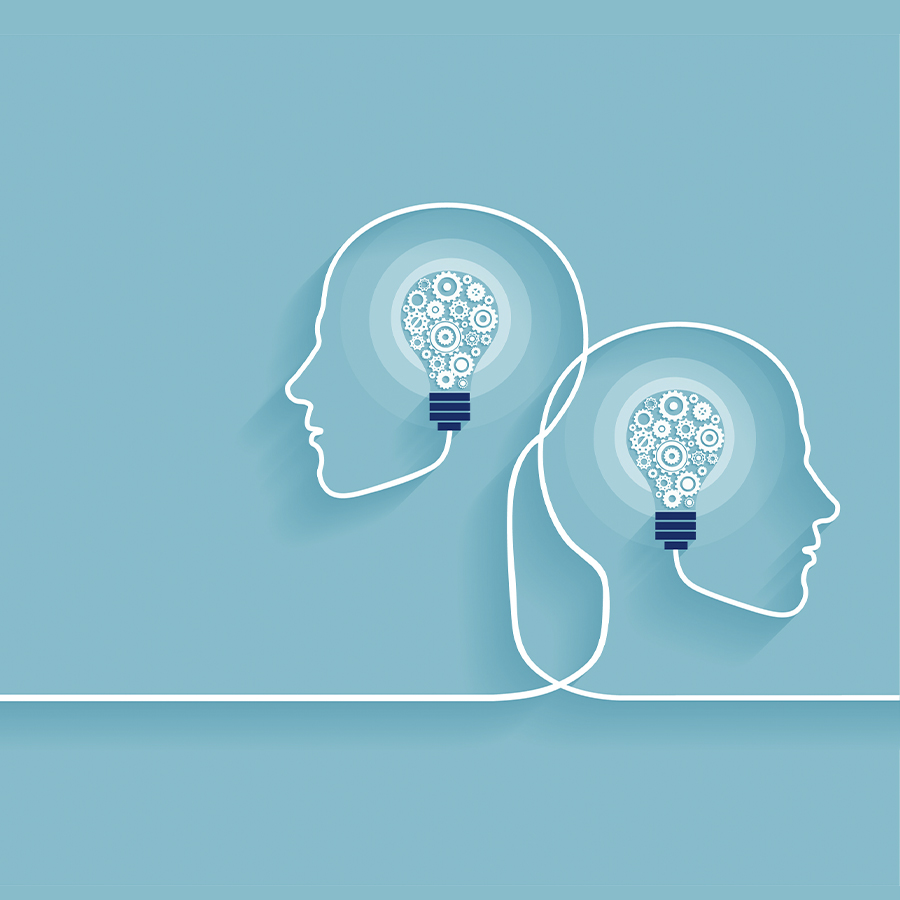 Moving The Dial On Mental Health
Moving The Dial On Mental Health -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview
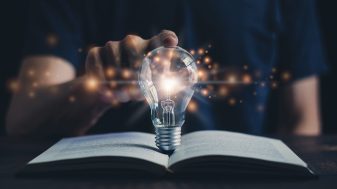
Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Brandschutz und in der Sachversicherung – Chancen und Herausforderungen

August 21, 2025
Leo Ronken
Deutsch
English
Die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in sicherheitsrelevante Anwendungsfelder hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, so auch im Bereich des Brandschutzes und der Sachversicherung. Die Anwendung künstlicher Intelligenz eröffnet dabei neue Möglichkeiten zur Risikoidentifikation, ‑bewertung und ‑minimierung sowie effizientere Schadenregulierung. KI‑basierte Technologien wie maschinelles Lernen, Bild- und Spracherkennung oder sensorbasierte Datenanalyse ermöglichen eine automatisierte Auswertung großer Datenmengen aus unterschiedlichsten Quellen – wie Sensordaten, Wetterinformationen oder Gebäudestrukturen in Echtzeit – und unterstützen dadurch sowohl die frühzeitige Erkennung potenzieller Gefahren sowie Prognosen zu Schadenwahrscheinlichkeiten. Dies verspricht eine signifikante Verbesserung der Überwachungs- und Reaktionsmechanismen, etwa durch lernende Algorithmen zur Detektion von Brandereignissen oder durch die adaptive Steuerung brandschutztechnischer Anlagen.
Darüber hinaus ermöglicht die KI die Optimierung versicherungstechnischer Prozesse, so können neben präziseren Schadenanalysen neue Formen der Tarifierung, Schadenregulierung und Betrugserkennung entwickelt werden.
Im Rahmen dieses Artikels sollen mögliche Potenziale und Herausforderungen des Einsatzes Künstlicher Intelligenz im Zusammenspiel von Brandschutz und Sachversicherung beispielhaft dargestellt werden. Dabei werden sowohl technologische als auch versicherungsökonomische Aspekte beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis für die Chancen und Herausforderungen sowohl des KI‑Einsatzes im Rahmen des Brandschutzes als auch der Anwendung für die Sachversicherung zu entwickeln.
Künstliche Intelligenz
Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) bezieht sich auf die Entwicklung von Computeralgorithmen und ‑systemen basierend auf künstlichen neuronalen Computernetzwerken, die es ermöglichen, unterschiedliche Datenquellen wie Bilder, Töne, Texte, Tabellen oder Zeitreihen zu interpretieren und Informationen oder Muster zu extrahieren, um diese auf unbekannte Daten anzuwenden. Künstliche neuronale Netze sind das zentrale Element im Deep Learning (besonders tiefe Netzstrukturen). Sie sind in der Lage, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern würden. Der Begriff KI umfasst eine Vielzahl von Technologien und Methoden, dazu zählen insbesondere:
- Lernen aus Daten (Machine Learning)
- Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing)
- Bilderkennung (Computer Vision)
- autonome Entscheidungsfindung.
KI‑Algorithmen können beispielsweise Muster erkennen, Sprache verstehen, Entscheidungen treffen, Probleme lösen und eigenständig lernen und sich verbessern, d. h., KI‑Systeme weisen zumindest einen gewissen Grad an Autonomie, Anpassungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zu Schlussfolgerungen auf.
Die Effektivität von KI‑Systemen hängt maßgeblich von der Qualität und Quantität der verfügbaren Daten ab, die insbesondere im Hinblick auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) datenschutzkonform sein müssen.
Einsatzmöglichkeiten von KI im Brandschutz
Im Rahmen von Smart Buildings werden Gebäude zunehmend mit verschiedensten intelligenten KI‑gestützten Infrastruktur-Steuerungstechnologien ausgerüstet und untereinander vernetzt. Dabei übernimmt die KI die Analyse sowie die Bewertung der eingehenden Datenströme und die Steuerung notwendiger Maßnahmen, beispielsweise bei einem beginnenden Brand die Auslösung eines Brandalarms, die Aktivierung von Brandschutzeinrichtungen wie Brandschutzklappen, Feuerschutzabschlüssen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie die Einleitung von Evakuierungsmaßnahmen. Weitere Beispiele sind Videoüberwachungssysteme, die es durch die KI‑Technologie ermöglichen, eine Rauchentwicklung zu erkennen oder Systeme, die je nach Brandentwicklung dynamisch sichere Evakuierungsrouten ermöglichen.
Die Anwendung Künstlicher Intelligenz eröffnet damit Möglichkeiten, Brandgefahren frühzeitig zu erkennen sowie entsprechende Folgeprozesse wie Alarmierung und Einleitung von Brandbekämpfungsmaßnahmen zu automatisieren. KI‑gestützte Systeme können sowohl im präventiven als auch im abwehrenden Brandschutz eingesetzt werden.
Präventiver Brandschutz
Primäre Aufgabe des präventiven Brandschutzes ist die Vermeidung von Brandentstehung und die Begrenzung der Ausbreitung durch bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen. Im Brandschutz können KI‑gestützte Systeme Sensordaten, Umgebungsvariablen und historische Ereignisse auswerten sowie ungewöhnliche Wärmemuster oder Rauchentwicklung durch ein Netzwerk aus hochsensiblen Sensoren, Wärmebild- und Überwachungskameras sowie Luftqualitätsmessgeräten feststellen, bevor sie ggf. für den Menschen oder konventionelle Sensoren wahrnehmbar sind. So lassen sich überhitzte Geräte, fehlerhafte Elektroinstallationen oder ungewöhnliche Rauchentwicklungen automatisiert identifizieren. Diese vorausschauenden Systeme ermöglichen eine Reaktion noch vor dem Eintritt des Schadenereignisses und tragen so wesentlich zur Erhöhung der Sicherheitsstandards bei, da sie Brandgefahren frühzeitig erkennen und präventive Maßnahmen einleiten.
Mögliche Einsatzbereiche von KI‑gestützten Systemen:
- Brandfrüherkennung durch intelligente Sensorik, indem KI‑basierte Systeme schneller und zuverlässiger als konventionelle Branderkennungsanlagen zwischen echten Brandereignissen und Staub- und Rauchentwicklung durch Betriebsprozesse durch die Datenanalyse von Mustern und kontextbezogenen Informationen von Wärmebildkameras, Gassensoren und Rauchmeldern unterscheiden und so Falschalarme reduzieren. Dies verbessert die Reaktionszeiten für Einsatzkräfte und Brandschutzsysteme und kann Schäden erheblich reduzieren oder sogar verhindern. KI‑gestützte Brandfrüherkennungssysteme kommen zurzeit besonders zum Einsatz in Unternehmensbereichen, die Wind, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und/oder Staub ausgesetzt sind.
- Brandrisikomodellierung und Szenarioanalyse komplexer Zusammenhänge beispielsweise aus Gebäude‑, Prozess‑ und Schadendaten, die mit klassischen Methoden schwer zu erfassen sind. Sie kommen bevorzugt im Rahmen der Brandschutzplanung (KI‑gestützte Simulationen) im virtuellen Raum unter Verwendung von Informationen aus verschiedenen Quellen wie Gebäudestrukturen, Elektroinstallationen, historischen Branddaten und Wetterbedingungen zum Einsatz. Im Kontext des Building Information Modelling (BIM) können derart optimierte und effizientere Gebäudekonstruktionsentwürfe unter direkter Berücksichtigung der geltenden Bau- und Brandschutzvorschriften, potenzieller Brandgefahren und ‑szenarien sowie der Simulation des Verhaltens von Konstruktionen über ihren Lebenszyklus aus implementierten, von vernetzten Sensoren gewonnenen Daten angefertigt werden.
- Instandhaltungsplanung gesteuert durch KI, um sicherheitsrelevante Anlagen wie Brandmelde- oder Brandbekämpfungssysteme zur frühzeitigen Erkennung von potenziellen Ausfällen oder Mustern, die auf einen baldigen Wartungsbedarf hindeuten können, zu überwachen (Predictive Maintenance). Sie unterstützen so u. a. das Montage- und Wartungspersonal, mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie sich auswirken können.
Abwehrender Brandschutz
Im abwehrenden Brandschutz kann KI die Einsatzplanung, Brandbekämpfung, Entscheidungsfindung und Koordination während eines Brandereignisses maßgeblich beeinflussen und optimieren, beispielsweise durch:
- Echtzeitanalyse der Einsatzsituation (z. B. durch Auswertung von Sensor- und Gebäudedaten sowie Wetterinformationen) und der Ableitung von Handlungsempfehlungen, z. B. Ausbreitungsprognosen, Priorisierung gefährdeter Gebäudebereiche, Ermittlung der besten Methode zur Brandbekämpfung, Ermittlung der optimalen Route für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung von Verkehr und Straßenbedingungen, der notwendigen Ressourcen (z. B. Feuerwehrfahrzeuge, Personal und Ausrüstung), der Brandlokalisierung sowie Ermittlung der besten Evakuierungsrouten für Personen mit dynamischen Beschilderungen, mobilen Warnungen sowie automatischer Steuerung von Türen, Aufzügen und Lüftungsanlagen
- Drohnen- und Robotikunterstützung mittels KI‑gesteuerter Drohnen zur Lageerkundung z. B. zur Lokalisierung von Brandherden oder Personensuche
- Unterstützung bei der Schadenbeurteilung durch Auswertung von Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Wärmebildaufnahmen oder Drohnen), um die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft des Unternehmens, die Schadenabwicklung sowie die Gewinnung von Erkenntnissen für künftige Präventionsmaßnahmen zu unterstützen
- KI‑gestützte Simulationen und Training von möglichen realitätsnahen Einsatzsituationen für Einsatzkräfte durch die Analyse von historischen Daten und Echtzeitinformationen zur Optimierung der Verteilung von Ressourcen wie Löschkräften und Ausrüstung
- Automatisierte Notfallreaktion und ‑management durch autonome Aktivierung von Alarmsystemen, Ansteuerung von automatischen Brandbekämpfungseinrichtungen, sowie weiteren Maßnahmen, z. B. Steuerung der Klima‑ / Lüftungs- und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Brandschutztüren und ‑klappen
- Optimierung der Leistung von Brandbekämpfungssystemen wie Sprinkler, Löschmonitore durch eine von KI‑Algorithmen in Echtzeit gesteuerte dynamische Anpassung der Wasserleistung, Aktivierung der Löschbereiche sowie optimale Verteilung des Löschwassers, z. B. für eine effektivere Brandbekämpfung und Minimierung von Wasserschäden in Bezug auf die tatsächliche Branddynamik. Weiterhin werden Löschkräfte bei der Brandbekämpfung in gefährlichen Zonen und Umgebungen bzw. schwer zugänglichen Stellen unterstützt. Durch die Optimierung angepasster Löschtaktiken sind u. a. geringere Schadenfolgen zu erwarten.
Zurzeit lösen KI‑basierte Brandschutzsysteme Einzelprobleme. Nach wie vor ist es eine unabdingbare Notwendigkeit, ergänzende bauliche, technische, betriebliche und organisatorische Brandschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Zukünftig ist aber zu erwarten, dass verbesserte Sensorik und Datenanalyse die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von KI‑basierten Brandschutzanwendungen erhöhen werden. Zudem werden Roboter zum Einsatz kommen, die autonom in gefährlichen / unzugänglichen Umgebungen zur Brandbekämpfung eingesetzt werden können sowie KI‑basierte Technologie und Systeme in eine umfassende Sicherheitsstrategie zur Gewährleistung maximaler Sicherheit und Bekämpfung multipler Bedrohungspotenziale (z. B. Brandschutz, Intrusionsschutz, Überwachung) integriert werden.
Einsatzmöglichkeiten von KI in der Sachversicherung
Die Integration von KI in den Bereichen Brandschutz und Sachversicherung markiert einen tiefgreifenden technologischen Wandel mit weitreichenden Auswirkungen auf Prävention, Risikomanagement und Kundenerfahrung. Bisher wird das Versicherungsexposure im Wesentlichen auf der Grundlage menschlicher Intuition, Erfahrung, Wissen, historischer Daten, versicherungsmathematischer Tabellen und zahlreicher statistischer Analysen bestimmt. Es ist ein umständlicher und zeitaufwendiger manueller Prozess, gekennzeichnet durch Risikobesichtigung, Berichterstellung, Bewertungsverfahren, Prämientarifierung. Er beinhaltet das inhärente Problem, dass historische Daten durch Technologieveränderungen und Umweltprozesse beschränkt zur Verfügung stehen und nur bedingt Vorhersagen von Schadenbelastungen aus Katastrophenereignissen ermöglichen.
Eine permanente kontinuierliche Sammlung, Verknüpfung und Abgleichung aller verfügbaren Daten in Echtzeit (z. B. Schadendaten, IoT‑Geräte-Feeds, Social-Media-Aktivitäten, Finanzunterlagen, Wetterberichte, Satellitenaufnahmen) können individuelle, bestehende Risikopotenziale erkennen und darauf abgestimmte Deckungskonzepte entwickeln. KI‑gesteuerte Prozesse erlauben die Erkennung von Mustern und Zusammenhängen von strukturierten/ unstrukturierten Daten, um eine dynamischere und genauere Risikoexposure-Bewertung vorzunehmen und so effizientere / risikoadäquatere Entscheidungen zu treffen. Weiterhin würden Technologie- und Umweltveränderungen in der Risikobewertung sowie Deckungskonzepte und Versicherungsprämien an die individuellen Bedürfnisse jedes Versicherungsnehmers in Echtzeit an die bestehende Realsituation schneller berücksichtigt werden können. Weitere Vorteile liegen in einer Simulation / Vorhersage möglicher Schäden (z. B. Katastrophenszenarien) zur besseren Individualisierung der Versicherungsprämie und Deckungskonzepte sowie einer besseren Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für den Versicherungsnehmer. Auch die Vorhersagefähigkeiten und Risikomanagementpraktiken zur besseren strategischen Allokation von Kapital und Ressourcen können verbessert werden, um etwaige Verluste für Versicherer zu mindern.
Beispiel Risikobewertung und Prämienkalkulation
Zentrales Element der Sachversicherung ist die Exposure-Feststellung und einer darauf basierenden adäquaten Prämie im Hinblick auf die im Versicherungsvertrag versicherten Gefahren wie Feuer, Explosion, Blitzschlag oder Leitungswasserschäden. Traditionell erfolgt diese Bewertung auf Grundlage standardisierter Risikomodelle, historischer Schadenstatistiken und versicherungsmathematischer Methoden.
Mit der Anwendung von KI eröffnen sich neue Möglichkeiten zur präziseren, dynamischeren und individuelleren Risikoeinschätzung. Aus der Vielzahl von gesammelten Prozess- und Schadendaten, z. B. Telematik- und Sensordaten können im Vergleich zu den traditionellen Methoden komplexere Muster und nichtlineare Zusammenhänge berücksichtigt werden, die es ermöglichen, eine Vielzahl weiterer Risikoindikatoren (u. a. Geo‑, Umwelt‑, Anlagendatendaten) sowie die daraus resultierenden Wechselwirkungen gleichzeitig automatisiert zu analysieren und so präzisere Exposure-Modelle zu erstellen. Dies erlaubt eine laufend aktualisierte Risikobewertung auf der Basis neu hinzukommender Risikodaten, z. B. Veränderungen im Systemzustand von Maschinen und Anlagen, Nutzungsänderungen oder Veränderungen vom Umweltdaten.
Damit ergibt sich die Möglichkeit, die notwendige Versicherungsprämie dynamisch auf die jeweilige Risikosituation und die damit verbundenen potenziellen Gefährdungen anzupassen. Gleichzeitig ist eine größere Differenzierung zwischen Risiken gleicher Betriebsart, aber unterschiedlicher Gebäude‑, Infra- und Sicherheitsstruktur möglich, sodass die Genauigkeit der Risikoeinschätzung gesteigert werden kann. Damit kann auch die Allokation von Zeichnungs- und Rückversicherungskapazität präziser durch eine Risikomodellierung optimiert werden.
Neben diesen Vorteilen sind damit aber auch eine Reihe von Herausforderungen verbunden: KI‑Modelle und Algorithmen sind in der Regel sehr komplex und deren Ergebnisse nur schwierig nachzuvollziehen. Hinzu kommen regulatorische, datenschutzrechtliche und ethische Herausforderungen, denn personalisierte sensible Daten können zu Diskriminierungen in der Risikoeinschätzung führen. Zudem müssen die Risikomodelle regelmäßig überprüft und an neue Risikosituationen angepasst werden.
Beispiel Personalisierung von Versicherungsleistungen durch KI
Zunehmend werden in der Sachversicherung Stimmen laut, anstelle standardisierter Deckungskonzepte Sachversicherungspolicen stärker an die tatsächlich bestehenden individuelle Risikosituation und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers anzupassen. Auch sollen sich Policen schneller und flexibler an Veränderungen der Risikosituation anpassen.
Die KI‑Technologie bietet die Möglichkeit, durch die Auswertung vorhandener Daten (z. B. Objekt- und Prozessdaten, Geodaten) individuelle Risikoprofile zu erstellen, und gewünschte Versicherungsleistungen mit einer bestehenden Risikosituation abzugleichen. Dies ermöglicht es, eine bedarfsgerechte und effiziente Versicherungslösung entsprechend der prognostizierten Risikosituation anzubieten, eine potenzielle Über- aber auch Unterversicherung zu vermeiden sowie eine der Risikosituation angemessene Prämie zu berechnen. Mögliche Gestaltungsformen sind beispielsweise:
- Dynamische Tarifgestaltung
Prämien orientieren sich an der tatsächlichen Nutzung und dem Verhalten des Versicherungsnehmers – z. B. durch IoT-Sensorik in Gebäuden oder regelmäßige Instandhaltungsnachweise. - Adaptive Policen
Automatische Anpassung des Versicherungsbedarfes bzw. Optionen für einen verbesserten Versicherungsschutz beispielsweise bei Zukauf von Maschinen, Aufnahme neuer Betriebsprozesse. - Empfehlungssysteme
Ermittlung und Vorschlag eines passgenauen Versicherungsschutzes durch den Versicherer aufgrund historischer Kundendaten bzw. vergleichbarer Risikosituationen im Portefeuille eines Versicherers. - Kundensegmentierung
Vorschlag und Erstellung wirtschaftlich interessanter und individualisierter Angebote für eine spezifische Risikogruppe durch Identifizierung und Clusterung von homogenen Risikogruppen.
Herausforderungen des KI-Einsatzes im Brandschutz und in der Sachversicherung
Obwohl der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Brandschutz sowie in der Sachversicherung eine Vielzahl von vorteilhaften Möglichkeiten aufzeigt, sind damit nicht unerhebliche Herausforderungen verbunden. Sie lassen sich zusammengefasst wie folgt beschreiben:
- Datenverfügbarkeit und ‑qualität
Die Leistungsfähigkeit von KI‑Modellen hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit großer, qualitativ hochwertiger Datenmengen ab. Insbesondere im Brandschutzbereich fehlen häufig standardisierte und zugängliche Datenpools. Eventuell ist mit einer abnehmenden Zuverlässigkeit und Genauigkeit der KI‑Systeme durch die steigende Komplexität der Technologie, technischer Komponenten und Vernetzung zu rechnen. - Transparenz und Erklärbarkeit
Viele KI‑Modelle, insbesondere Deep-Learning-Ansätze, agieren als sogenannte Black Boxes, und liefern keine unmittelbar nachvollziehbaren Entscheidungsgrundlagen. Ihre Entscheidungen sind für Versicherungsnehmer, Regulierungsbehörden Aufsichtsbehörden und internen Fachabteilungen sowie teilweise auch für Entwickler schwer nachvollziehbar. Dies führt möglicherweise zum Verlust an Verifizierungsmöglichkeiten und entzieht sich damit menschlicher Kontrollen. - Regulatorische und datenschutzrechtliche Anforderungen
Die Verwendung personenbezogener Daten erfordert die Einhaltung maßgeblicher Datenschutzvorgaben (z. B. DSGVO). Dies betrifft u. a. Einwilligungsmanagement, Datenverwendung im Rahmen der Zweckbindung, berechtigtes Interesse an der Datenverwendung, Speicherbegrenzung und die Beachtung des Prinzips der Datenminimierung sowie die Etablierung technischer Schutzmaßnahmen wie Pseudonymisierung sowie Überwachungs- und Zugriffskontrolle. Insbesondere im Brandschutz (z. B. durch Videoanalytik, Bewegungserkennung oder Smart-Home-Sensorik) stellt sich die Frage, inwiefern die kontinuierliche Datenerhebung in den privaten Lebensraum eingreift. Dies führt zu einem erheblichen Aufwand zur Einhaltung von bestehenden Standards, Datenschutzregeln und ‑gesetzen, ggf. sind notwendige Anpassungen an länderspezifische Gegebenheiten, Regelungen und Gesetze sowie Gepflogenheiten erforderlich. - Diskriminierungsrisiken und unzuverlässige / fehlerbehaftete autonome Entscheidungsfindung
Fehlende oder unvollkommene Daten, zweifelhafte Datenherkunft, Datenaufbereitung sowie fehlerhafte Algorithmen oder Programmierung bzw. unzureichende oder mangelhafte Vernetzung von Daten und Anwendungen können zu Verzerrungen und Diskriminierungen führen und damit zu unsachgemäßen, voreingenommenen und unfairen Entscheidungen durch KI‑Systeme. Dies kann im Rahmen von Versicherungskonzepten zu benachteiligenden Risikoselektionen, Prämienmodellen oder Ausschlüssen bestimmter Risiken oder im Brandschutzbereich zu falschen Rückschlüssen und Entscheidungen führen. - Akzeptanz durch Kunden und Beschäftigte
Die Einführung KI‑basierter Systeme erfordert Vertrauen in deren Fairness und Funktionalität. Versicherungsnehmer könnten automatische Entscheidungen als intransparent oder unpersönlich empfinden. Gleichzeitig werden erhöhte Anforderungen an die Fähigkeiten der Beschäftigten bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI‑Technologien gestellt. - Systemintegration und Interoperabilität
Derzeitiges Problem für KI‑Anwendungen ist, dass extrem viele Daten notwendig sind, um nach Abschluss des Lerntrainings die jeweiligen zu erwartenden Situationen zu erkennen. Neue, nicht vorher erkannte und eingelernte Situationen müssen mit ihren Systemparametern von Grund auf erfasst und trainiert werden. Bestehende IT‑Infrastrukturen in Versicherungsunternehmen und Brandschutzsystemen sind häufig historisch gewachsen und heterogen. Die Integration KI‑basierter Komponenten in bestehende Prozesse erfordert deshalb eine umfassende Schnittstellenentwicklung und Kompatibilitätsprüfungen, wenn nicht gar komplett neue Systeme. - Mangel an Fachkompetenz
Die Entwicklung, Implementierung und Wartung KI‑basierter Systeme erfordern interdisziplinäres Know-how in den Bereichen Data Science, IT‑Sicherheit, Versicherungsmathematik und Fachprozessverständnis. Der Mangel an entsprechend qualifizierten Fachexperten, Softwareentwicklern und Datenwissenschaftlern in den Bereichen Brandschutz/KI und Sachversicherung stellt zurzeit beispielsweise eine zentrale Hürde dar. - Widerstand gegen Veränderung
Die Einführung neuer Technologien verändert Rollenbilder, Verantwortlichkeiten und Arbeitsprozesse. Ohne aktives Change-Management kann dies zu Widerstand in der Belegschaft führen, insbesondere wenn Beschäftigte den Nutzen der KI nicht nachvollziehen können oder Angst um den eigenen Arbeitsplatz haben. - Governance und Verantwortlichkeit
KI‑Systeme erfordern neue Strukturen der Verantwortung und Aufsicht. Es muss klar definiert sein, wer für die Entscheidungen und Handlungen algorithmischer Systeme haftet, beispielsweise Software‑/Anlagen-Entwickler oder Anwender. Dies gilt insbesondere bei fehlerhaften Prognosen oder Diskriminierungsvorwürfen. - Kulturelle Transformation
Die erfolgreiche Integration von KI ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch der Unternehmenskultur. Offenheit gegenüber datengetriebenen Entscheidungen, Fehlerakzeptanz und eine lernorientierte Haltung müssen gezielt gefördert werden. - Versicherungsaufsichtsrecht
Auch das Versicherungsaufsichtsrecht (z. B. VAG, Solvency II) stellt Anforderungen an die Implementierung neuer Technologien. Dabei muss der Einsatz von KI beispielsweise bei einem Sachversicherungsunternehmen in einem angemessenen Verhältnis zu den Versicherungsrisiken stehen und darf die Finanzstabilität nicht gefährden. Weiterhin müssen Versicherungsunternehmen über eine angemessene Unternehmensorganisation verfügen, die auch den Einsatz algorithmischer Systeme kontrolliert (z. B. interne Kontrollsysteme, Compliance-Strukturen, IT‑Risikomanagement) - Cyberbedrohung
Die Integration von KI- und IoT-Technologien in Brandschutzsysteme eröffnet neue Ansatzpunkte für Cyberbedrohungen beispielsweise um die Funktionalität von Brandschutzsystemen zu kompromittieren. Insofern besteht die Notwendigkeit permanenter Updates, um potenzielle Schwachstellen auszumerzen sowie die Implementierung erhöhter Cybersicherheit von Brandschutzsystementwicklern und ‑herstellern in Design- und Implementierungsprozessen, z. B. robuste Verschlüsselungsprotokolle und Durchführung regelmäßiger Sicherheitsaudits.
Die mit dem Einsatz der KI Technologie verbundenen erheblichen Vorteile in der Sachversicherung und im Brandschutz sind im Hinblick auf Schadenvermeidung, Wirtschaftlichkeit und Servicequalität gegenüber den damit verbundenen Herausforderungen technischer aber auch gesellschaftlicher Natur abzuwägen. Für einen nachhaltigen Erfolg wird es notwendig sein, einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten, transparente Entscheidungsprozesse und die vorhandenen ethischen und regulatorischen Standards miteinander zu vernetzen.
Zusammenfassung
KI hat das Potenzial, die Art und Weise, wie über Brand- und Versicherungsschutz nachgedacht und wie er umgesetzt wird, grundlegend zu verändern. Der Einsatz von KI im Bereich des Brandschutzes sowie der Versicherung aber auch in anderen Anwendungsbereichen befindet sich noch in einem relativ frühen Stadium, wird sich aber weiterentwickeln und zunehmend sowohl im Brandschutz als auch in der Sachversicherung Einzug halten. Die Zukunft der KI verspricht einen dynamischeren, reaktionsschnelleren und personalisierten Ansatz zur Risikobewältigung sowie der Risikobewertung. Verbesserte prädiktive Analysen, die auf ständig wachsenden Datensätzen und Echtzeitinformationen basieren, werden es beispielsweise Versicherern ermöglichen, einen effizienteren, datengesteuerten und proaktiven Versicherungsschutz anzubieten.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) unterliegt einer Vielzahl rechtlicher Vorgaben, die den sicheren, fairen und diskriminierungsfreien Umgang mit datengetriebenen Technologien gewährleisten sollen. Neben bestehenden datenschutzrechtlichen und versicherungsrechtlichen Regelungen gewinnt mit der KI‑Verordnung der Europäischen Union1 ein spezifisch auf KI zugeschnittener Regulierungsrahmen zunehmend an Bedeutung. Unternehmen müssen daher sowohl nationale als auch europäische Normen beachten, um rechtliche Risiken zu vermeiden und Vertrauen bei Kunden und Aufsichtsbehörden zu schaffen.
Trotz der zahlreichen Potenziale, die der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Sachversicherung und im Brandschutz bietet, ist ihre flächendeckende Implementierung mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Diese betreffen sowohl technologische Voraussetzungen als auch strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen innerhalb der Organisationen. Eine erfolgreiche Einführung erfordert daher ein integriertes Management dieser Herausforderungen, das technische Innovationen mit organisatorischer Transformationsbereitschaft verknüpft. Zum heutigen Zeitpunkt sind nicht unerhebliche Anfangsinvestitionen in die Technologie sowie in die dafür notwendige Infrastruktur erforderlich.
Langfristig ist davon auszugehen, dass KI‑Anwendungen nicht nur punktuelle Verbesserungen ermöglichen, sondern zu einem grundlegenden Strukturwandel in der Versicherungswirtschaft und im präventiven Brandschutz führen werden. Die Entwicklung intelligenter, autonom agierender Systeme sowie die tiefere Integration von IoT, Big Data und Edge Computing markieren den Weg zu einem datengetriebenen, adaptiven Versicherungswesen.
Endnote
- Verordnung (EU) 2024/1689 des europäischen Parlaments und des Rates v. 13.6.2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689, zuletzt aufgerufen am 25. Juli 2025.
- Aguirre u. Rodriguez, Automation of a Business Process Using Robotic Process Automation (RPA): A Case Study, in: Workshop on Engineering Applications, 2017, S. 65‑71, Springer Nature Link: https://link.springer.com/conference/woea.
- Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG), https://www.gesetze-im-internet.de/ttdsg/.
- European Commission, Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), 2021, COM(2021) 206 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206.
- European Parliament and Council, Regulation (EU) 2016/679 – On the protection of natural persons with regard to the processing of personal data on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (GDPR), 2016, Official Journal of the European Union, L 119, 1‑88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.
- Gentsch, Künstliche Intelligenz für Sales, Marketing und Service: Mit AI und Bots zu einem Algorithmic Business, 2019, Springer Gabler, https://doi.org/10.1007/978-3-658-23060-9.
- Raji u. Buolamwini, Actionable Auditing: Investigating the Impact of Publicly Naming Biased Performance Results of Commercial AI Products. In Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (pp. 429‑435), 2019, https://dl.acm.org/doi/10.1145/3306618.3314244.
- Russell u. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., 2021, Pearson, https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292401171_A41586057/preview-9781292401171_A41586057.pdf.
- Jordan u. Mitchell, Machine learning: Trends, perspectives, and prospects, Science, 2015, 349(6245), 255‑260, https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa8415.
- DIN 14011:2015‑01. Begriffe im Feuerwehrwesen, Deutsches Institut für Normung.
- Brennecke (Hrsg.), Handbuch Brandschutz. Springer Vieweg, 2019.
- Ahrens, U.S. Experience with Smoke Alarms and Other Fire Detection/Alarm Equipment, National Fire Protection Association (NFPA), 2013, 103, https://www.researchgate.net/publication/267553848_US_Experience_with_Smoke_Alarms_and_Other_Fire_DetectionAlarm_Equipment.
- DIN 14675‑1:2020. Brandmeldeanlagen – Aufbau und Betrieb, Deutsches Institut für Normung.
- How mature is AI adoption in financial services, PricewaterhouseCoopers GMBH, May 2020, https://www.pwc.de/de/future-of-finance/how-mature-is-ai-adoption-in-financial-services.pdf.
- Döring u. Schmieder, Versicherungswirtschaft: Grundlagen – Produkte – Unternehmen, 2022, Springer Gabler.
- Farny, Versicherungsbetriebslehre, 6. Aufl. 2011, VVW.
- Grundmann, (Hrsg.), Versicherungsvertragsrecht, 2020, C.H. Beck.
- Gabler Wirtschaftslexikon, Stichworte Sachversicherung, Brandschutz, KI, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/.
- Wende u. Richter, Big Data und Künstliche Intelligenz in der Versicherung – Potenziale und Herausforderungen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, ZfV 2018, 107(3), 205‑229.
- Artificial Intelligence Governance Principles: Toward Ethical and Trustworthy Artificial Intelligence in the European Insurance Sector,2021, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), https://www.eiopa.europa.eu/publications/artificial-intelligence-governance-principles-towards-ethical-and-trustworthy-artificial_en.
Alle Webseiten zuletzt aufgerufen am 11.7.2025.