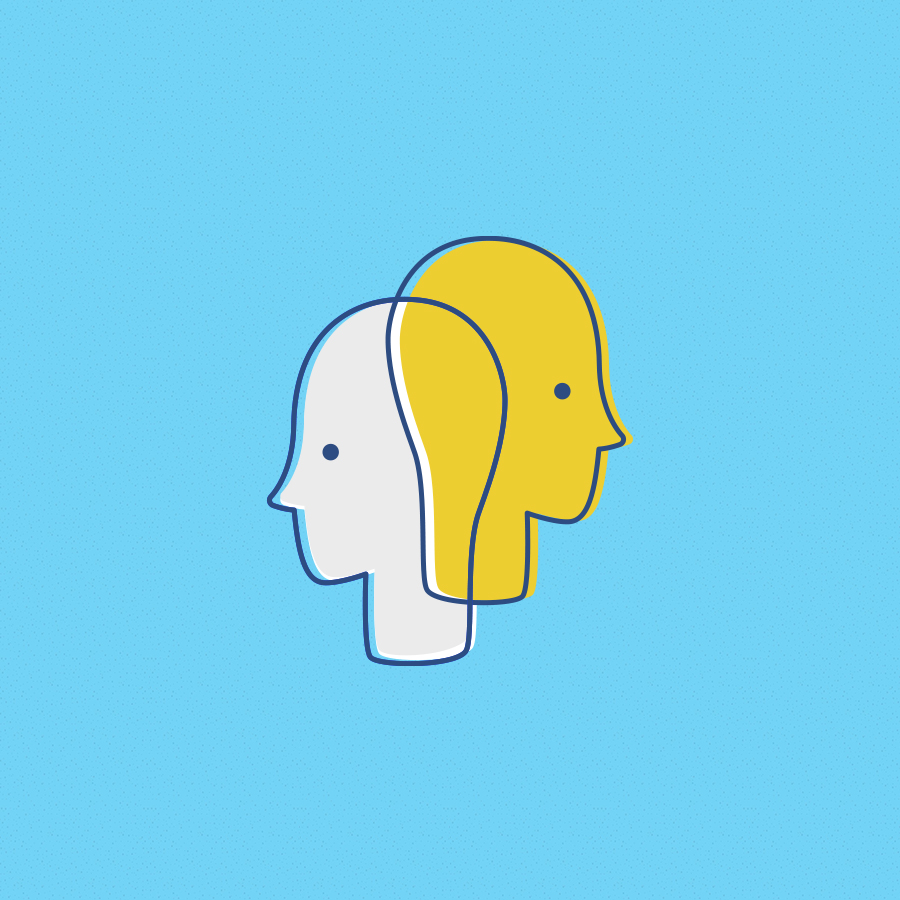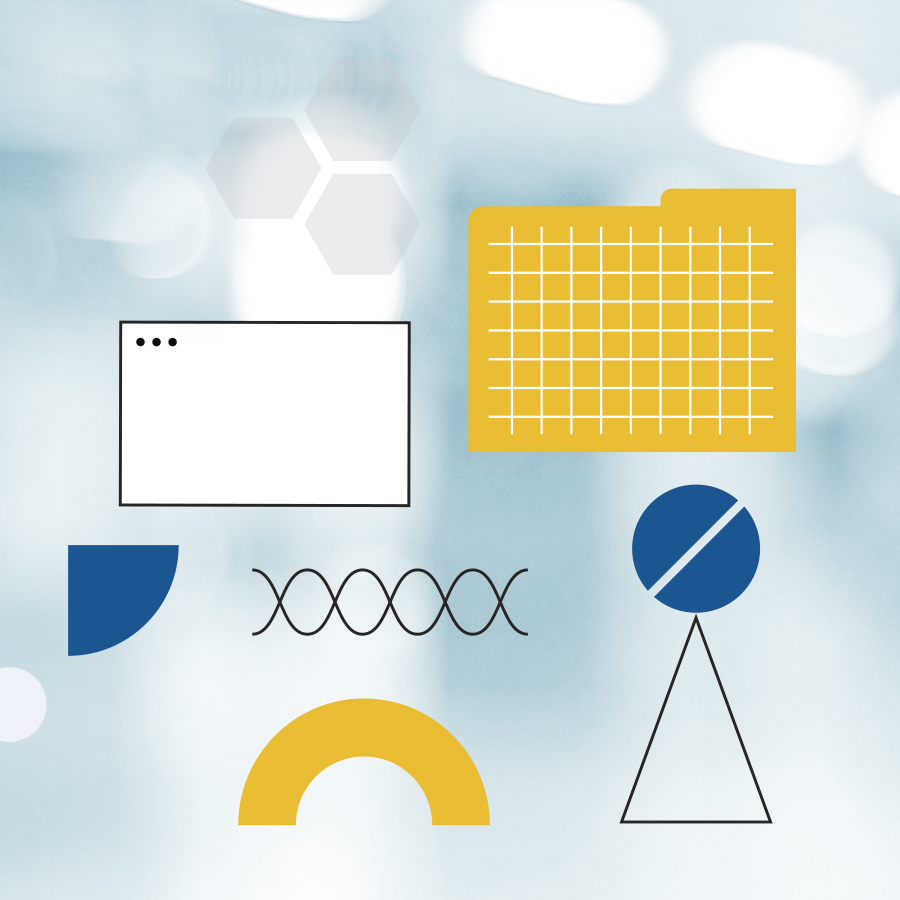-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Expertise
Publication
Structured Settlements – What They Are and Why They Matter
Publication
PFAS Awareness and Concern Continues to Grow. Will the Litigation it Generates Do Likewise?
Publication
“Weather” or Not to Use a Forensic Meteorologist in the Claims Process – It’s Not as Expensive as You Think
Publication
Cyber Risks – Deepfake Exposures
Publication
Georgia and Louisiana Pass Sweeping Tort Reform Legislation. What Does It Aim to Do and What Are the Implications for Insurers?
Publication
That’s a Robotaxi in Your Rear-View Mirror – What Does This Mean for Insurers? -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Publication
Highlights from the Group Term Life and AD&D Market Survey – Growth and Stability
Publication
Favorite Findings – Behavioral Economics and Insurance
Publication
Understanding Physician Contracts When Underwriting Disability Insurance
Publication
Voice Analytics – Insurance Industry Applications [Webinar] U.S. Industry Events
U.S. Industry Events
Publication
The Mass Phenomenon of Esports – A Look Behind the Screen -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview
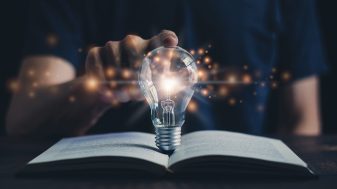
Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
Von Sprachentwicklungsstörungen bis zu psychischen Diagnosen – Risikoprüfung im Kindesalter

July 16, 2025
Annika Luckmann
Deutsch
Die fiktiven Fälle dieses Artikels dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Sie veranschaulichen die Bandbreite möglicher Antragstellenden, denen man im Rahmen der Risikoprüfung begegnen kann. Ein möglicher Bezug zu wahren Personen ist rein zufälliger Natur.
Die Risikoprüfung bei Kindern folgt eigenen Gesetzen. Anders als bei Erwachsenen erfordert sie ein besonders differenziertes Vorgehen – nicht nur wegen der abweichenden Deckungselemente, Leistungsauslöser und Produktspezifikationen, sondern vor allem aufgrund von individuellen Entwicklungsgeschichten.
Entwicklungsverzögerungen, Lernstörungen oder frühe Anzeichen psychischer Belastungen verlangen von Risikoprüfenden ein sensibles Gespür dafür, was vorübergehende Phasen sind und was auf eine dauerhafte Beeinträchtigung hinweisen könnte. Einträge im U‑Heft, die im späteren Lebensverlauf an Bedeutung verlieren, dürfen nicht überbewertet werden. Zugleich erfordert der Umgang mit Diagnosen wie Depressionen oder Angststörungen besondere Aufmerksamkeit, da deren Bewertung im Kindesalter anderen Maßstäben unterliegt als bei Erwachsenen.
Verbreitung von Entwicklungs‑, Lern- und psychischen Störungen
Sprachentwicklungsstörungen (SES) betreffen rund 7 %1 der Kinder im Vorschulalter. Während etwa ein Drittel der Zweijährigen als sogenannte „späte Sprecher“ gilt, entwickelt sich die Sprachkompetenz bei vielen Kindern ohne langfristige Auffälligkeiten weiter. Eine verzögerte Sprachentwicklung ist somit nicht automatisch mit einer SES in engerem Sinne gleichzusetzen. Logopädische Interventionen und differenzialdiagnostische Abklärungen spielen eine zentrale Rolle – oft mit guter Prognose.
Motorische Entwicklungsstörungen nehmen hingegen seit Jahren deutlich zu. Daten der Kaufmännischen Krankenkasse zeigen einen Anstieg um 64 %2 bei 6‑ bis 18‑Jährigen zwischen 2008 und 2023. Ein wesentlicher Einflussfaktor ist der Mangel an Bewegung im Alltag, der eine gesunde Entwicklung von Fein- und Grobmotorik erschweren kann.
Auch Dyslexie (eine Störung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit) wird inzwischen von Fachleuten zunehmend als neurobiologische Entwicklungsstörung statt als reine Lernschwäche betrachtet. Studien belegen, dass das Gehirn geschriebene Sprache anders verarbeitet und Buchstaben sowie Wörter nicht automatisch als Einheiten erkennt. Im Gegensatz dazu lassen sich Lernstörungen wie die Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oftmals durch gezieltes Training verbessern. In Deutschland betrifft LRS etwa 5 %3 der Kinder, wobei zwischen isolierter Lese- oder Rechtschreibstörung und kombinierter Form unterschieden werden muss.
Hinzu kommt: Rechenschwächen und Leseprobleme treten häufig gemeinsam auf. Studien zufolge zeigen 30‑40 %4 der Kinder mit Rechenschwäche auch Leseschwierigkeiten – und umgekehrt. Diese Überschneidungen weisen darauf hin, dass kognitive Entwicklungsbereiche oft miteinander verwoben sind.
Bereits im Kindesalter zeigen sich vermehrt psychische Auffälligkeiten – besonders häufig handelt es sich um Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen. Dabei wirkte die Pandemie wie ein Katalysator. Der Anteil stationär behandelter Kinder mit Angststörungen stieg signifikant und liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie bis heute über dem Vor-Corona-Niveau. Ebenso verzeichnete die stationäre Aufnahme von Kindern mit Magersucht zwischen 2019 und 2023 einen Zuwachs von 42 %.5
Auffälligkeiten und Abweichungen – wann wird aus einer Verzögerung eine Störung?
Die kindliche Entwicklung verläuft nicht immer linear und nicht jedes verzögerte Verhalten ist automatisch pathologisch. Sprachliche, motorische, soziale oder kognitive Auffälligkeiten können sich im Einzelfall als vorübergehende Entwicklungsschritte herausstellen oder auf tieferliegende Schwierigkeiten hinweisen.
So kann es etwa in der Sprachentwicklung zu Verzögerungen beim Sprechen, Verstehen oder Anwenden kommen. Auch in der Fein- und Grobmotorik lassen sich Auffälligkeiten beobachten – etwa beim Greifen, Balancieren oder Werfen. Weitere Entwicklungsbereiche betreffen die soziale Interaktion (z. B. Freundschaften aufbauen) sowie die kognitive Leistungsfähigkeit wie logisches Denken oder Problemlöseverhalten.
Zeigt ein Kind in einem oder mehreren dieser Bereiche deutliche Abweichungen, stellt sich zunächst die Frage: Handelt es sich um eine einmalige Auffälligkeit – oder um eine stabile, längerfristige Abweichung vom typischen Entwicklungsverlauf?
Manche Kinder entwickeln bestimmte Fähigkeiten langsamer, etwa im Bereich des mathematischen Denkens oder in der Konzentrationsfähigkeit. Solche Unterschiede können jedoch temporärer Natur sein und fallen nicht immer außerhalb des Normrahmens. Langfristige Auffälligkeiten hingegen bestehen über einen längeren Zeitraum und betreffen meist mehrere Entwicklungsbereiche gleichzeitig.
Gerade deshalb ist es entscheidend, dass die U‑Untersuchungen sorgfältig dokumentiert werden, denn sie bieten eine wertvolle Grundlage für Verlaufseinschätzungen. Zeigen Eltern, Erziehende oder Lehrkräfte Auffälligkeiten auf, beginnt ein mehrstufiger Abklärungsprozess, bevor eine gesicherte Diagnose gestellt werden kann.
Im Mittelpunkt steht zunächst das Anamnesegespräch mit Eltern oder Bezugspersonen. Hier geht es um frühkindliche Entwicklung, familiäre Hintergründe sowie aktuelle Beobachtungen. Ergänzend erfolgen direkte Beobachtungen des Kindes – sei es beim Spiel, in der Kita oder zu Hause – durch qualifizierte Fachkräfte. Diese sind besonders aufschlussreich, wenn das Verhalten im sozialen oder schulischen Kontext auffällt.
Zur objektiven Einschätzung kommen standardisierte Fragebögen und Tests zum Einsatz. Diese erfassen Fähigkeiten und Verhalten in den Bereichen Kognition, Sprache, Motorik und soziale Interaktion. Auf dieser Basis lässt sich die individuelle Entwicklung mit normativen Alterswerten vergleichen. Ergänzend liefern psychologische Testungen Hinweise auf Intelligenz, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung.
Eine Diagnose wird nicht leichtfertig gestellt. Sie basiert auf festgelegten Kriterien, wie sie im DSM‑5 oder ICD‑10/11 definiert sind, sowie auf einem Abgleich mit altersentsprechenden Normwerten. Die abschließende Bewertung erfolgt durch ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Kinderärztinnen und ‑ärzten sowie Psychologinnen und Psychologen, die die Ergebnisse gemeinsam besprechen und bewerten.
Praxisbeispiel Anna
Anna ist fünf Jahre alt und zeigt seit einiger Zeit Auffälligkeiten in ihrer sprachlichen Entwicklung sowie im sozialen Miteinander. Ihre Eltern berichten, dass sie kaum vollständige Sätze bildet und häufig nicht auf Fragen reagiert. Zudem zieht sie sich oft zurück und spielt lieber allein.
In einem ausführlichen Gespräch mit dem Kinderarzt berichten die Eltern, dass Anna bislang keine gesundheitlichen Probleme hatte, jedoch seit dem Kita-Besuch Schwierigkeiten beim Sprechen und im Umgang mit anderen Kindern zeigt. Um Annas sprachliche und soziale Auffälligkeiten zu beurteilen, durchläuft sie folgende Maßnahmen:
- Fragebogen: Die Eltern füllen einen standardisierten Fragebogen aus, der Annas Sprach- und Sozialverhalten dokumentiert.
- Direkte Beobachtung: Eine Fachkraft beobachtet Anna im Kindergarten. Dabei fällt auf, dass sie selten Kontakt zu anderen Kindern sucht und Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck hat. Ihr Verhalten wird in unterschiedlichen Situationen analysiert, beispielsweise beim freien Spiel, im Gruppengeschehen und bei geführten Aktivitäten.
- Sprachentwicklungstest: Ein standardisierter Sprachtest ergibt, dass Annas sprachliche Fähigkeiten deutlich unter dem Altersdurchschnitt liegen.
- Psychologischer Test: Zur Abklärung möglicher Ursachen wird ein Intelligenztest durchgeführt. Das Ergebnis liegt im Normbereich, was nahelegt, dass die Sprachprobleme nicht durch eine generelle kognitive Beeinträchtigung bedingt sind.
- Diagnosestellung: Mithilfe der DSM‑5-Kriterien wird eine Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) diagnostiziert. Die Ergebnisse werden mit Normwerten für fünfjährige Kinder abgeglichen, um die Abweichung zu belegen. Kinderärztin und Fachkraft erarbeiten gemeinsam eine individuell zugeschnittene Therapieempfehlung.
- Behandlung: Anna beginnt eine regelmäßige Sprachtherapie, um ihre sprachlichen Fähigkeiten gezielt zu fördern. Zusätzlich werden im Kindergarten Maßnahmen ergriffen, um sie aktiv in soziale Situationen einzubeziehen und ihre interaktionellen Kompetenzen zu stärken.
Praxisbeispiel Max
Max ist acht Jahre alt und zeigt seit Beginn der Grundschule anhaltende Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Seine Lehrkräfte berichten, dass er häufig Buchstaben vertauscht, Wörter falsch liest und Texte nur schwer versteht. Trotz intensiven Übens bleiben Fortschritte aus, was seine Eltern zunehmend beunruhigt.
Im Gespräch mit dem Kinderarzt geben sie an, dass Max bereits beim Erlernen des Alphabets Schwierigkeiten hatte, obwohl es keine familiären Vorbelastungen mit Lernstörungen gibt. Um Max‘ Herausforderungen beim Lesen und Schreiben zu beurteilen, durchläuft er folgende Schritte:
- Fragebögen: Eltern und Lehrkräfte füllen standardisierte Erhebungsinstrumente aus, die Max‘ schriftsprachliche Kompetenzen und schulisches Verhalten erfassen.
- Beobachtung: Eine Fachkraft begleitet Max im Unterricht. Dabei zeigt sich, dass er beim Lesen häufig stockt, Wörter vertauscht und beim Schreiben Buchstaben verdreht oder auslässt. Auch im Klassenzimmer fällt auf, dass er bei schriftlichen Aufgaben mehr Zeit benötigt und schneller ermüdet.
- Testungen: Ein Lesetest bestätigt, dass Max‘ Lesefähigkeit deutlich unter dem Altersdurchschnitt liegt. Ein ergänzender Schreibtest zeigt vergleichbare Defizite. Um andere Ursachen auszuschließen, werden kognitive und intelligenzdiagnostische Verfahren eingesetzt. Diese zeigen kein auffälliges Ergebnis.
- Diagnose: Die Auswertung gemäß DSM‑5 ergibt eine spezifische Lernstörung mit Beeinträchtigung beim Lesen und Schreiben – Dyslexie genannt. Die Ergebnisse werden mit altersentsprechenden Normdaten abgeglichen, um die Diagnose abzusichern.
- Förderung: Max erhält eine gezielte wöchentliche Therapie, die auf den Aufbau von Lese- und Schreibstrategien ausgerichtet ist. Auch im Unterricht wird er durch individuelle Maßnahmen unterstützt, wie beispielsweise durch verlängerte Bearbeitungszeiten, den Einsatz von hilfreichen Lernmaterialien sowie die enge Zusammenarbeit mit den Eltern, um die Förderung auch zu Hause fortzusetzen zu können.
Psychische Auffälligkeiten
Psychische Erkrankungen sind auch im Kindesalter möglich. Laut einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigen etwa 22 %6 der Kinder und Jugendlichen in Deutschland psychische Auffälligkeiten. 2018 lag dieser Wert laut Robert Koch-Institut noch bei 16,9 %7 – eine deutliche Verschlechterung, die insbesondere auf die Pandemiejahre zurückgeführt ist.
Die Nutzung digitaler Medien ist ein weiterer relevanter Faktor. Der intensive Gebrauch von Smartphones und sozialen Netzwerken kann das Risiko für psychische Probleme erhöhen.8 Gleichzeitig gelten ein stabiler sozioökonomischer Hintergrund sowie ein unterstützendes Umfeld als schutzfördernde Faktoren für die seelische Gesundheit.
Praxisbeispiel Greta
Greta ist zehn Jahre alt und hat zunehmend Schwierigkeiten im sozialen Miteinander. In der Schule meidet sie es, vor anderen zu sprechen, hat Angst vor Gruppenaktivitäten und zieht sich zunehmend zurück. Zu Hause klagt Greta regelmäßig über Bauchschmerzen und zeigt auffällige Schulvermeidung.
Ihr Kinderarzt überweist sie an eine psychologische und psychiatrische Fachstelle. Dort werden im Gespräch mit Greta und ihren Eltern Symptome, Entwicklungsgeschichte und ihr aktuelles Verhalten detailliert erfasst. Greta durchläuft folgende Maßnahmen:
- Fragebögen und Interviews: Standardisierte Instrumente ermöglichen eine strukturierte Erhebung von Ängsten, Rückzugsverhalten und psychosomatischen Symptomen.
- Beobachtungsbögen: Eltern und Lehrkräfte dokumentieren Gretas Verhalten im Alltag, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
- Diagnose: Nach Auswertung aller Informationen stellt der Kinderpsychiater / die Kinderpsychiaterin anhand der ICD‑10-Kriterien die Diagnose soziale Angststörung. Entscheidende Anhaltspunkte sind Vermeidungsverhalten, körperliche Stresssymptome und deutlicher Leidensdruck in sozialen Situationen.
- Behandlung: Für Greta wird ein individueller Therapieplan erstellt. Dieser umfasst wöchentliche Verhaltenstherapie sowie ein Elterntraining, um auch das häusliche Umfeld gezielt einzubinden.
Psychische Gesundheit – ein Lagebild aus Schulen
Laut dem Deutschen Schulbarometer sind 79 % der Schülerinnen und Schüler psychisch unauffällig, jedoch befinden sich 9 % in grenzwertigem Bereich und 12 % zeigen klinisch relevante Auffälligkeiten. Rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen erhält Unterstützung aufgrund psychischer Probleme.9
Angststörungen und Depressionen gehören zu den häufigsten Diagnosen – die Tendenz steigt. Besonders betroffen sind jugendliche Mädchen. Laut dem DAK-Kinder- und Jugendreport10 stieg die Depressionsprävalenz in dieser Gruppe von 5,5 % (2019) auf 7,5 % (2023). Bei Angststörungen war ein Anstieg von 4,2 % auf 6,4 % zu verzeichnen. Die Zahl der Mädchen mit komorbider Angst und Depression hat sich im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelt.
Zwischen Potenzial und Prognose
Anna, Max und Greta stehen exemplarisch für Situationen, die auch in der Risikoprüfung immer häufiger auftreten. Ziel ist es, wie bei Erwachsenen, eine faire und sachlich begründete Einschätzung vorzunehmen, Antiselektion zu vermeiden und eine passende Votierung zu ermöglichen.
Gerade bei Berufsunfähigkeitspolicen für Kinder ist entscheidend, wie sich Leistungsauslöser im Schulalter und Optionen beim späteren Berufseinstieg gestalten. Viele Lernstörungen bessern sich im Schulverlauf durch gezielte Maßnahmen – das BU‑Risiko ist dadurch nicht zwingend erhöht.
Bei Entwicklungsstörungen oder neurodivergenten Kindern wie solchen mit ADHS oder Autismus kommt es darauf an, welche Fördermaßnahmen bereits greifen (z. B. Ergotherapie, Medikation) und wie das Kind im schulischen Alltag zurechtkommt. In unserem Handbuch finden sich spezifische Leitlinien für ADHS und Autismus.
Bei einer Grundfähigkeitsversicherung ist unter anderem zu prüfen, ob Pflegeleistungen enthalten sind. In Deutschland wird Eltern oft empfohlen, bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung oder ADHS einen Pflegegrad zu beantragen – auch dies ist relevant für die Risikobewertung.
Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass Neurodivergenz auch eine Ressource sein kann. Immer mehr Arbeitgebende erkennen in Mitarbeitenden mit ADHS, Autismus oder Dyslexie ein wertvolles Potenzial, denn sie denken anders, bringen neue Perspektiven ein und erhöhen die kreative Leistungsfähigkeit von Teams. Studien zeigen, dass neurodiverse Gruppen oft produktiver und resilienter sind11 – vorausgesetzt, es gibt passende Rahmenbedingungen.
In der Risikoprüfung heißt das: Die Diagnose allein sollte nicht automatisch als Risikofaktor gewertet werden. Vielmehr muss berücksichtigt werden, wie stark eine Person im Alltag unterstützt wird und wie stabil ihre psychische Gesundheit ist. Anpassungsfähigkeit, soziale Unterstützung sowie ein offener Umgang mit individuellen Bedürfnissen sind entscheidende Schutzfaktoren – auch im späteren Berufsleben.
Klar ist: Die Arbeitswelt ist meist auf neurotypische Verhaltensweisen ausgerichtet. Doch mit kleinen Anpassungen – sei es mehr Homeoffice, visuelle statt auditiver Anleitungen oder klare Strukturen und Deadlines – können Stärken sichtbar gemacht und gefördert werden.
Sorgfalt vor Urteil
Diagnosen im Kindesalter dürfen nicht vorschnell zu einer erhöhten Risikobewertung führen. Entscheidend ist ein differenzierter Blick auf das Zusammenspiel von Behandlung, Alltagstauglichkeit sowie Entwicklungspotenzial. Besonders bei bereits vorliegenden psychischen Diagnosen gilt es, mit besonderer Sensibilität vorzugehen.
Eine fundierte Risikoeinschätzung berücksichtigt deshalb den Verlauf bisheriger Therapien, die aktuelle psychische Verfassung und die Qualität des sozialen Umfelds, denn die Zukunft lässt sich nicht exakt berechnen. Doch mit einer sorgfältigen, differenzierten Prüfung kann sie fair gestaltet werden – auch und gerade bei jungen Antragstellenden.
- Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (n. d.). Sprachentwicklungsstörung. https://www.dbl-ev.de/fachwissen-logopaedie/sprachentwicklungsstoerung (abgerufen am 15.04.2025).
- KKH. (n. d.). Bewegungsstörungen. https://www.kkh.de/presse/pressemeldungen/bewegungsstoerungen (abgerufen am 15.04.2025).
- Tischler, L., Schipper, M. (2019). Lese- und Rechtschreibstörung. In: Schnell, T., Schnell, K. (Hrsg.) Handbuch Klinische Psychologie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45995-9_16-1 (abgerufen am 28.04.2025).
- Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. (2021). Elternratgeber Dyskalkulie. https://www.bvl-legasthenie.de/images/static/pdfs/bvl/3_ Elternratgeber_Dyskalkulie.pdf (abgerufen am 15.04.2025).
- Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH (2025). Coronazeit wirkt fort auf Psyche junger Menschen. Pharmazeutische Zeitung. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/coronazeit-wirkt-fort-auf-psyche-junger-menschen-153602/ (abgerufen am 15.04.2025).
- Kaman, A., Ravens‑Sieberer, U., Otto, C., Erhart, M., Devine, J., Hölling, H., & Lampert, T. (2024). Mental health of children and adolescents in times of global crises: Findings from the longitudinal COPSY study from 2020 to 2024 (Preprint). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=5043075 (abgerufen am 15.04.2025).
- Klipker, K., Baumgarten, F., Göbel, K., Lampert, T., & Hölling, H. (2018). Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. Journal of Health Monitoring, 3(3), 37–45.
- Kaman, A., Ravens‑Sieberer, U., Otto, C., Erhart, M., Devine, J., Hölling, H., & Lampert, T. (2024). Mental health of children and adolescents in times of global crises: Findings from the longitudinal COPSY study from 2020 to 2024 (Preprint). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=5043075 (abgerufen am 15.04.2025).
- Robert Bosch Stiftung (2024). Deutsches Schulbarometer 2024 – Jeder fünfte junge Mensch berichtet von psychischen Problemen. https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/deutsches-schulbarometer-schueler-2024-jeder-fuenfte-junge-mensch-berichtet-von-psychischen-problemen (abgerufen am 15.04.2025).
- Witte, S., Zeitler, A., Hasemann, L., & Diekmannshemke, K. (2023). DAK-Kinder- und Jugendreport 2023. DAK-Gesundheit. https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/dak-kinder-und-jugendreport-2023_45524 (abgerufen am 15.04.2025).
- Mahto, M., Hogan, S. K., & Sniderman, B. (2022). A rising tide lifts all boats – Creating a better work environment for all by embracing neurodiversity. Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/ us164891_cir-career-paths-and-critical-success-factors-for-neurodivergent-workforce/DI_CIR_Career-paths-and-critical-success-factors-for-neurodivergent-workforce.pdf (abgerufen am 15.04.2025).