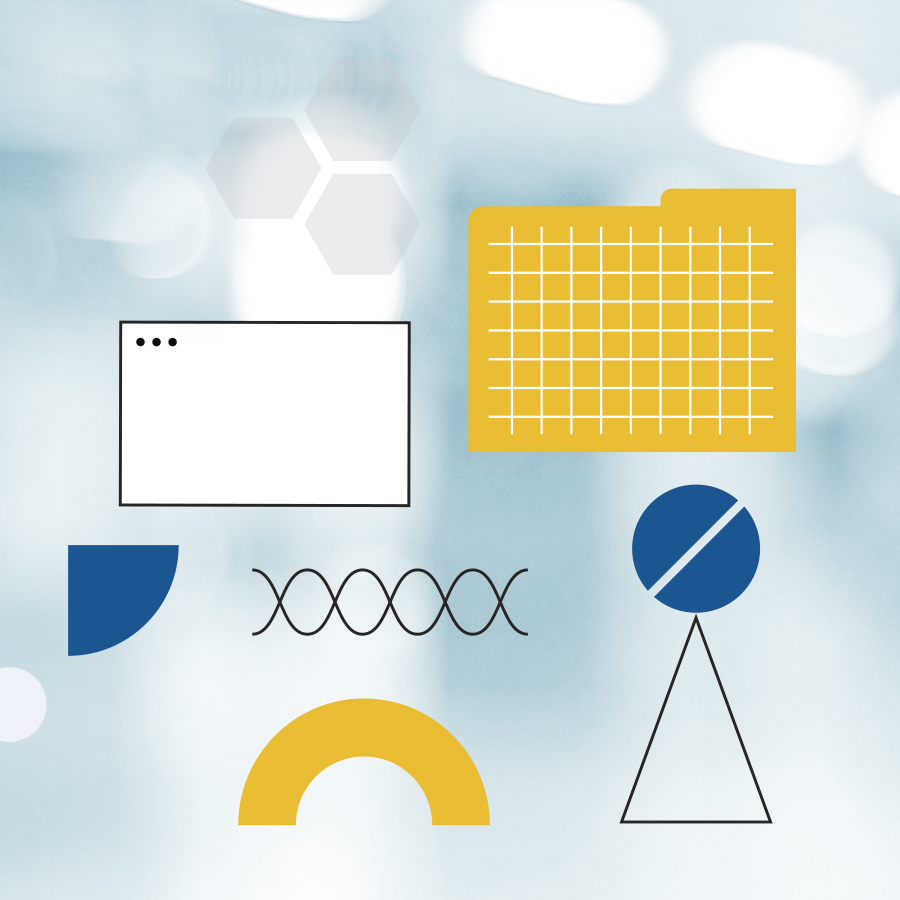-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Expertise
Publication
Production of Lithium-Ion Batteries
Publication
Time to Limit the Risk of Cyber War in Property (Re)insurance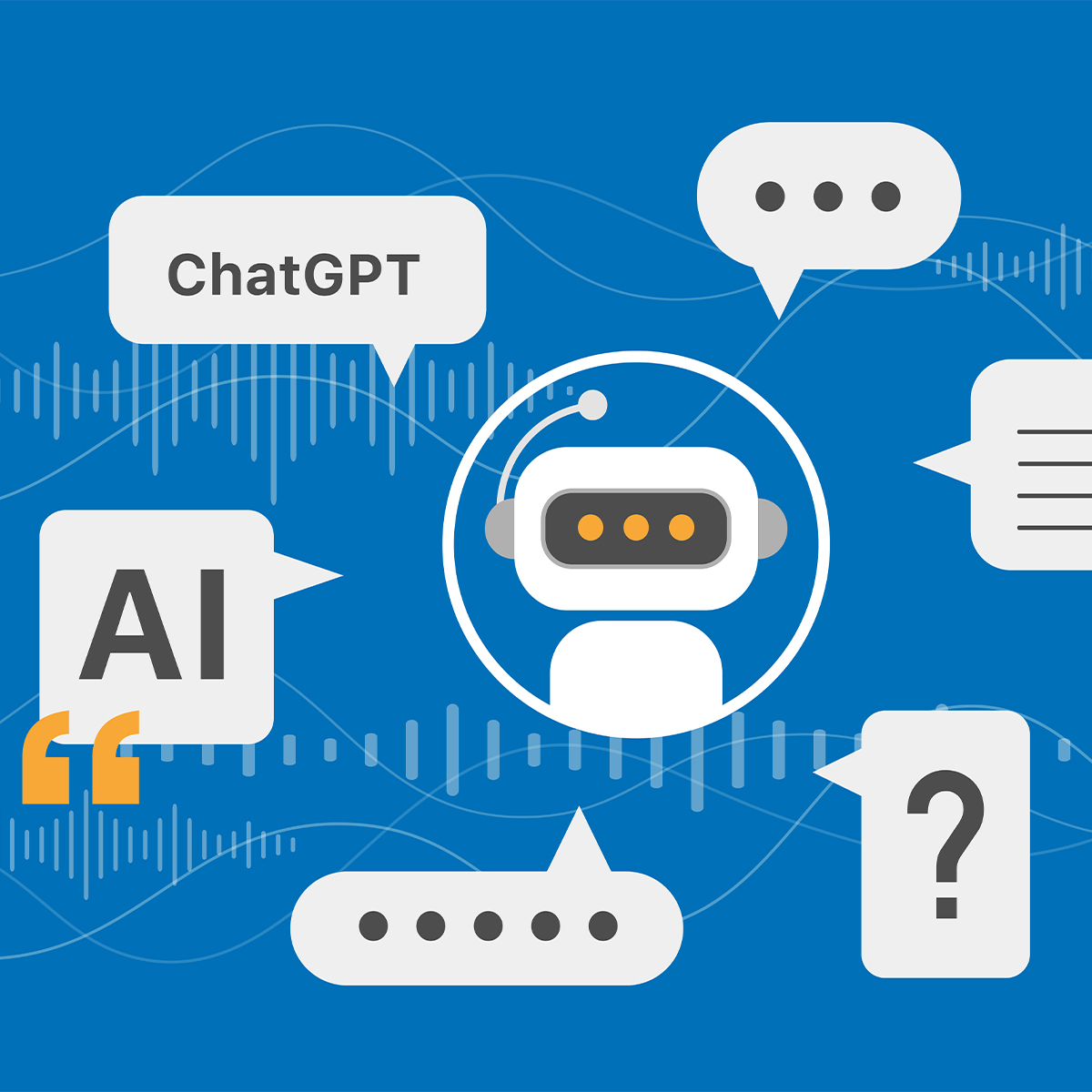
Publication
Generative Artificial Intelligence in Insurance – Three Lessons for Transformation from Past Arrivals of General-Purpose Technologies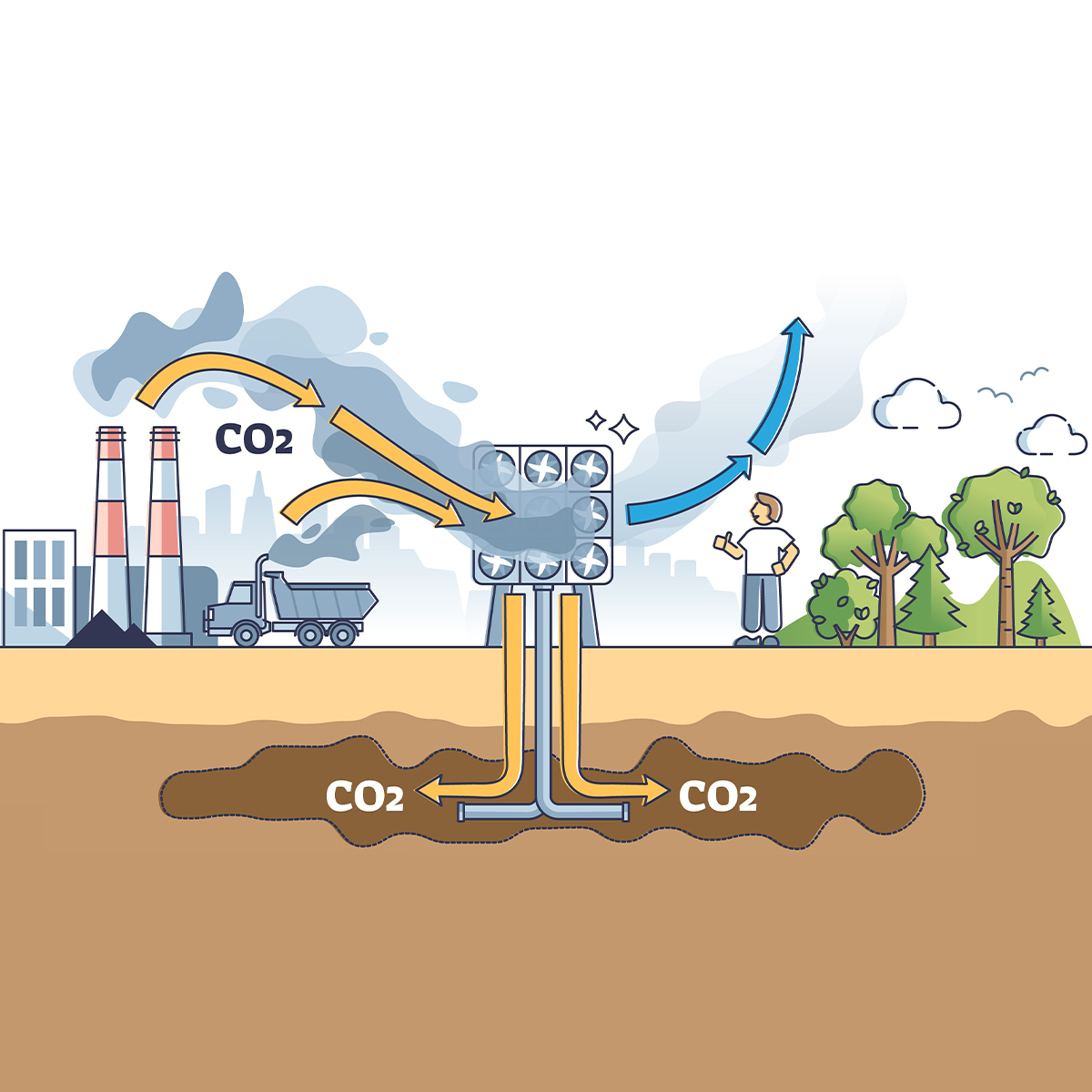
Publication
Human Activity Generates Carbon and Warms the Atmosphere. Is Human Ingenuity Part of the Solution?
Publication
Inflation – What’s Next for the Insurance Industry and the Policyholders it Serves? -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
Gen Re’s valuable insights and risk transfer solutions help clients improve their business results. With tailor-made reinsurance programs, clients can achieve their life & health risk management objectives.
UnderwritingTraining & Education
Publication
The Key Elements of Critical Illness Definitions for Mental Health Disorders
Publication
What Are We to Make of Cannabis Use in The Insured Population? Business School
Business School
Publication
Knife or Needle: Will the New Weight Loss Medication Replace Bariatric Surgery?
Publication
Weight Loss Medication of the Future – Will We Soon Live in a Society Without Obesity?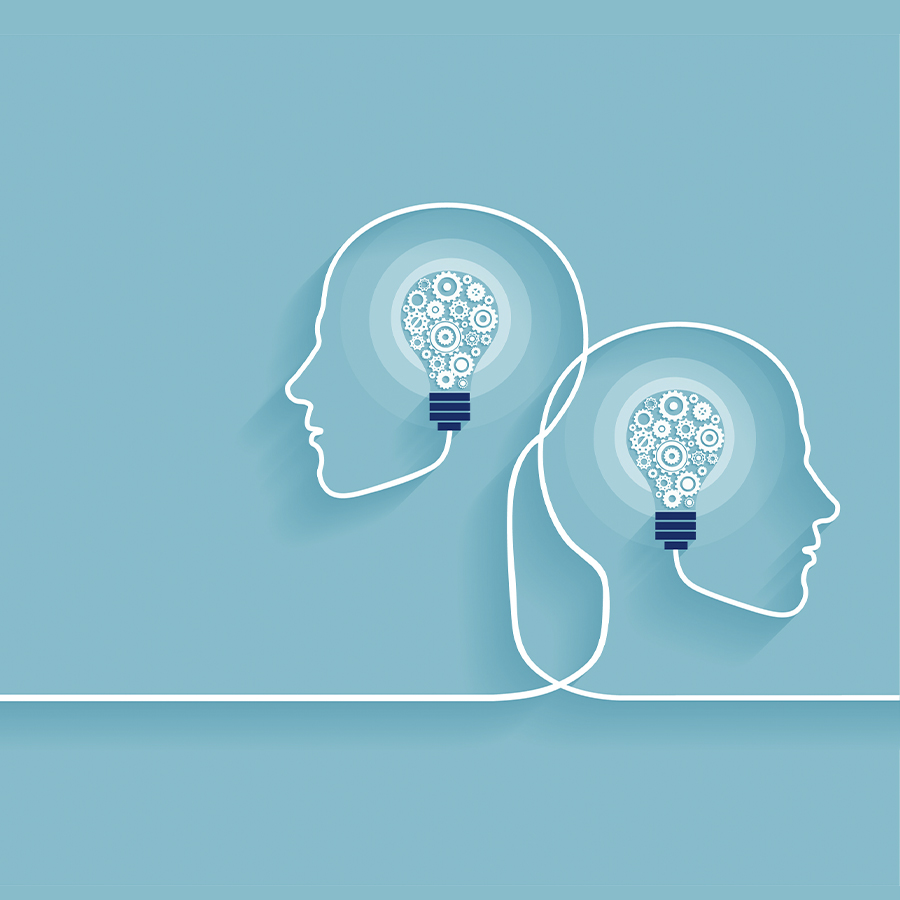 Moving The Dial On Mental Health
Moving The Dial On Mental Health -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview

Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
PHi-Newsletter 2017

December 31, 2017
Deutsch
- Ausgabe von November 2017
- Ausgabe von August 2017
- Ausgabe von Mai 2017
- Ausgabe von März 2017
- Ausgabe von Januar 2017
Möchten Sie künftige Ausgaben sofort nach Erscheinen erhalten? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen elektronischen Newsletter.
Ausgabe von November 2017
Deutschland/Peru – OLG Hamm: Klage eines Landwirts aus Peru gegen RWE wegen Klimawandelfolgen ist schlüssig
Das Oberlandesgericht Hamm (Az.: 5 U 15/17) hat in seiner mündlichen Verhandlung am 13. November 2017 die Schadensersatzklage eines peruanischen Landwirts gegen die RWE AG wegen der von ihr verursachten Treibhausgasemissionen vorläufig als schlüssig angesehen und einen Beweisbeschluss in Aussicht gestellt.
Der peruanische Landwirt Saúl Lliuya ist Miteigentümer eines Wohnhauses in der Stadt Huaraz, die am Fuß der Anden unterhalb des Gletschersees Laguna Palcacocha liegt. In der Vergangenheit war dieser Gletschersee infolge von Erdbeben und Erdrutschen ausgebrochen und hatte die Stadt Huaraz überflutet. Bei einem erneuten Gletscherseeausbruch würde das Haus des Klägers aller Voraussicht nach ebenfalls überschwemmt.
Während der Gletschersee Ende der 1930er-Jahre ein Wasservolumen von 10 - 12 Mio. m³ fasste, war dieses im Jahr 2009 auf 17,3 Mio. m³ gestiegen. Trotz Maßnahmen zur Senkung des Wasserpegels wurde im Februar 2016 aufgrund des Abschmelzens des Palcaraju-Gletschers ein Wasservolumen von 17,4 Mio. m³ gemessen.
Der Kläger behauptet, das Abschmelzen des Gletschers sei größtenteils auf den anthropogenen Klimawandel zurückzuführen. Der konkrete Verursachungsbeitrag der Beklagten am Klimawandel durch ihre Treibhausgasemissionen sei anhand von wissenschaftlichen Modellen errechenbar und messbar und belaufe sich auf 0,47 %.
Vor dem Landgericht Essen beantragte der Kläger festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, anteilig zu ihrem Beeinträchtigungsbeitrag (Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen), der durch das Gericht gem. § 287 ZPO zu bestimmen ist, die Kosten für geeignete Schutzmaßnahmen zugunsten des Eigentums des Klägers vor einer Gletscherflut aus der Laguna Palcacocha zu tragen.
Hilfsweise beantragte der Kläger, die Beklagte zu verurteilen, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass das Wasservolumen in der Laguna Palcacocha entsprechend dem Verursachungsbeitrag der Beklagten, der durch das Gericht nach § 287 ZPO zu bestimmen ist, reduziert wird, und weiter hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, an den Gemeindezusammenschluss X ihren Anteil in Höhe von EUR 17.000 an den zum Schutz des Klägers geeigneten Schutzmaßnahmen zu tragen. Der Kläger äußerst hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger EUR 6.384 für von ihm bereits durchgeführte Schutzmaßnahmen zu zahlen.
Das LG Essen wies die Klage als unzulässig und teilweise unbegründet ab:1
Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag seien nicht hinreichend bestimmt. § 287 ZPO sei allenfalls auf eine Bezifferung der Beseitigungskosten der vermeintlich drohenden Flutgefahr anzuwenden, bei der Feststellungsklage des Kläger sei eine Schätzung durch das Gericht nach § 287 ZPO nicht möglich. Dem zweiten Hilfsantrag sei nicht zu entnehmen, an wen gezahlt werden solle.
Der dritte Hilfsantrag sei zwar zulässig, aber unbegründet: Die Störereigenschaft der Beklagten sei aufgrund mangelnder äquivalenter und adäquater Verursachung der Beeinträchtigung zu verneinen. Wenn zahllose Groß- und Kleinemittenten Treibhausgase freisetzten, die sich ununterscheidbar miteinander vermischen, sich gegenseitig veränderten und letztlich über einen hochkomplexen Naturprozess eine Klimaänderung hervorriefen, ließe sich eine auch nur annähernd lineare Verursachungskette von einer bestimmten Emissionsquelle zu einem bestimmten Schaden nicht mehr feststellen. Unabhängig davon, dass bereits die äquivalente Kausalität bei Summationsschäden nicht gegeben sei, sei der Anteil der einzelnen Treibhausgasemittenten am weltweiten Klimawandel derart gering, dass der einzelne Emittent, und sei es ein Großemittent wie die Beklagte, die möglichen Folgen des Klimawandels nicht in erheblicher Weise erhöhe.
Der Kläger legte gegen die Entscheidung des Landgerichts Berufung ein und präzisierte seine Klageanträge. Die Entscheidung des OLG Hamm wird am 30. November 2017 verkündet.
Europäische Union – Kommission: Überarbeitung der Unterlassungsklagen-Richtlinie geplant
Die Europäische Kommission wird im ersten Quartal 2018 einen Vorschlag für eine Überarbeitung der "Richtlinie über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen" (2009/22/EG) vorlegen.
In einer vorläufigen Folgenabschätzung kommt die Kommission zu dem Schluss, dass eine Beibehaltung des Status quo – divergierende nationalstaatliche Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor Massenschäden – eine ungleichmäßige Rechtsdurchsetzung und unterschiedliche Bedingungen für Unternehmer in der EU mit sich bringen würde.
Denkbar wäre eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Unterlassungsklagen-Richtlinie auf Wirtschaftsbereiche wie Finanzdienstleistungen, Energie, Telekommunikation oder Umwelt. Verbraucherschutz- und Wirtschaftsverbände könnten als qualifizierte Einrichtungen die private Rechtsdurchsetzung befördern. Für unterfinanzierte qualifizierte Einrichtungen könnte gezielte finanzielle Unterstützung wie beispielsweise der Erlass von Gerichtsgebühren geschaffen werden, um den Zugang zur Justiz zu erleichtern. Dem rechtswidrig handelnden Unternehmer könnte die bußgeldbewehrte Pflicht auferlegt werden, die gerichtliche Unterlassungsverfügung öffentlich bekannt zu machen und die betroffenen Verbraucher – falls möglich – einzeln zu benachrichtigen. Diese könnten dann ihre Individualklageverfahren auf diese Unterlassungsverfügung stützen.
Alternativ könnte die Unterlassungsklagen-Richtlinie um kollektive Rechtsschutzmaßnahmen ergänzt werden. Qualifizierte Einrichtungen könnten dann bei den Gerichten und/oder Behörden nicht nur eine Unterlassungsverfügung, sondern gleichzeitig den Erlass einer Entschädigungsverfügung beantragen. Das Gericht könnte dann eine solche Verfügung erlassen oder die qualifizierte Einrichtung und den Antragsgegner zu außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen auffordern. Im Fall einer Einigung würde der Vergleich erst nach gerichtlicher Prüfung und Billigung vollstreckbar. Scheiterten die Verhandlungen, setzte das Gericht das Verfahren nach den mitgliedstaatlichen Regeln für Sammelklageverfahren fort. Diese Variante würde also erfordern, dass alle Mitgliedstaaten kollektive Rechtsschutzverfahren einführen.
Schweiz – Bundesgericht: Einhaltung technischer Normen entbindet nicht von Risikobeurteilung
Das Bundesgericht der Schweiz hat entschieden, dass eine umfassende Risikobeurteilung notwendig ist und geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, wenn von einer Maschine Gefährdungen ausgehen, die nicht durch die harmonisierte Norm abgedeckt werden.2
Im zugrundeliegenden Fall untersagte die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) der Beschwerdegegnerin – einer Aktiengesellschaft, die sich mit Handel, Konstruktion und Unterhalt von Anbaugeräten und Verschleißteilen zu Erdbewegungs- und Baumaschinen aller Art befasst – mit Verfügung vom 13. März 2014 das weitere Inverkehrbringen von Schnellwechseleinrichtungen eines bestimmten Typs ab dem 1. Januar 2016, solange diese nicht der EG-Maschinenrichtlinie (MRL - 2006/42/EG) entsprächen. Auslöser für das Verfahren waren zwei tödliche Unfälle im Zusammenhang mit Schnellwechseleinrichtungen für Bagger anderer Hersteller.
Auf die Beschwerde der AG hob das Bundesverwaltungsgericht die Verfügung auf. Hiergegen legten die Suva und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht ein.
Das Bundesgericht gab der Beschwerde statt und bestätigte die Verfügung der Suva:
Das Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG) bezwecke eine Harmonisierung der schweizerischen Produktevorschriften mit denjenigen der EU. Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften enthielten nur die grundlegenden Anforderungen, während deren Einhaltung grundsätzlich in der Eigenverantwortung des Herstellers oder Importeurs liege, was mit verschiedenen Konformitätsbewertungsverfahren sicherzustellen sei. Für die Konkretisierung der materiellen Anforderungen können technische Normen herangezogen werden, namentlich die durch die europäischen Normenorganisationen erlassenen und harmonisierten Normen.
Das Verfahren gemäß dem „Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen" (MRA) diene lediglich der Feststellung, dass das Produkt den festgelegten Anforderungen genügt (Art. 2 Ziff. 1 Begriff: Konformitätsbewertung MRA). In diesem Verfahren werde jedoch nicht geklärt, ob das Produkt den Anforderungen nach Art. 4 PrSG bzw. Art. 5 MRL entspreche. Letzteres werde lediglich vermutet, wobei die Vermutung in einem separaten Verfahren widerlegt werden könne.
Der Inverkehrbringer, der die bezeichneten Normen einhalte, könne grundsätzlich davon ausgehen, dass die Anforderungen von Anhang I MRL eingehalten sind, und zwar inklusive der in diesem Anhang enthaltenen Pflicht, eine Risikobeurteilung vorzunehmen. Die Konformitätsvermutung erstrecke sich jedoch nur auf diejenigen Anforderungen, die von den jeweiligen Normen erfasst werden. Insbesondere bei älteren Normen könne es vorkommen, dass sie nicht alle sicherheitsrelevanten Aspekte umfassen. Die Anwendung harmonisierter Normen entbinde den Hersteller somit nicht völlig von der Pflicht, eine Risikobeurteilung durchzuführen.
Im vorliegenden Fall sei zwar das Risiko einer nicht korrekten Verriegelung der Schnellwechseleinrichtung von der Norm SN EN 474-1 abgedeckt, so dass die Konformitätsvermutung gem. Art. 5 Abs. 2 PrSG gelte. Diese sei jedoch widerlegt, da die betreffende Norm für vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen (wie das Übersehen einer mangelhaften Verriegelung) keine Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine vorsehe, also keine Beseitigung oder Minimierung dieser Risiken. Organisatorische Maßnahmen – also Schutzmaßnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen – könnten jedoch erst dann ergriffen werden, wenn technisch bauliche Maßnahmen unverhältnismäßig wären. Die Norm berücksichtige daher einen fundamentalen Aspekt der Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nicht, weshalb die entsprechenden Schnellwechseleinrichtungen, die sich an dieser Norm orientierten, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen verletzten.
Tschechien – Vorschlag zur Einführung kollektiven Rechtsschutzes
Das tschechische Justizministerium hat am 26. September 2017 die Einführung von Sammelklagen in der Tschechischen Republik angeregt. Wenn die Regierung zustimmt, wird das Ministerium spätestens Ende 2018 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.
Das Fehlen kollektiver Rechtsschutzmöglichkeiten war vor Kurzem vom tschechischen Verfassungsgericht kritisiert worden.
Nach dem Vorschlag des Ministeriums soll das Sammelklageverfahren in Opt-out-Form gestaltet werden, d. h. jeder Betroffene, der die Voraussetzungen erfüllt, wird automatisch in den Rechtsstreit einbezogen, sofern er sich nicht ausdrücklich dagegen ausspricht. Die unterlegene Partei muss die Kosten des Verfahrens tragen, der Klägeranwalt erhält bei Prozessgewinn einen prozentualen Anteil der zugesprochenen Summe (ein Novum im tschechischen Zivilprozessrecht). Gerichtlich genehmigte Vergleiche müssen rechtmäßig sein und die gemeinsamen Interessen aller Kläger wahren.
Zuständig für Sammelklageverfahren sollen nur spezialisierte oder höhere Gerichte sein. Zugelassen werden darf eine Sammelklage nur, wenn sie wegen der Gemeinsamkeiten als der vorzugswürdige prozessuale Weg erscheint, mit den betreffenden zahlreichen Klageverfahren umzugehen. Zudem muss sie hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten und darf nicht mutwillig sein.
Endnoten
- Urt. v. 15.12.2016, Az.: 2 O 285/15.
- Urt. v. 10.4.2017, Az.: 2C_75/2016, 2C_76/2016.
Ausgabe von August 2017
Deutschland – BGH: Punitive Damages verstoßen nicht zwangsläufig gegen ordre public
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Vollstreckbarerklärung einer ausländischen Entscheidung, die den Kläger wegen missbräuchlicher oder mutwilliger Prozessführung verurteilt, dem Beklagten über die Erstattung der Prozesskosten hinaus einen pauschalierten Betrag zum Ersatz nicht näher bezifferter Nachteile zu bezahlen, nicht dem ordre public widerspricht (Beschluss vom 22. Juni 2017, Az.: IX ZB 61/16).
Die Klage des Antragsgegners gegen die Antragstellerin vor dem Tribunale di Milano war am 13. Dezember 2011 wegen mangelnder internationaler Zuständigkeit abgewiesen worden. Die Berufung des Antragsgegners wies die Corte d'Appello di Milano (Appellationsgericht Mailand) am 24. Juni 2015 als offensichtlich unbegründet zurück. Das Appellationsgericht legte dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens auf (EUR 15.000 zzgl. Gerichtsgebühren, nachfolgender Kosten und allgemeiner Kosten gemäß den geltenden Gesetzen; insgesamt EUR 17.940) und verurteilte den Antragsgegner zusätzlich, an die Antragstellerin aufgrund verschärfter Haftung wegen missbräuchlichen Rechtsstreits gem. Art. 96 Abs. 3 Codice di Procedura Civile (CPC) weitere EUR 15.000 zu zahlen.
Das Landgericht Hamburg erklärte das Urteil mit Beschluss vom 23. November 2015 für vollstreckbar. Die Beschwerde des Antragsgegners beim Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg blieb erfolglos.
Der BGH verwarf die Rechtsbeschwerde des Antragsgegners als unzulässig. Insbesondere verletze der angefochtene Beschluss den Antragsgegner nicht in seinem Recht auf ein faires Verfahren gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK:
Nach Art. 34 Nr. 1 EuGVVO a. F. (Brüssel I-VO) werde eine Entscheidung nicht anerkannt, wenn dies der öffentlichen Ordnung (dem ordre public) des betreffenden Staats offensichtlich widersprechen würde. Maßgeblich sei hierbei, ob das Ergebnis der Anwendung ausländischen Rechts im konkreten Fall zu den Grundgedanken der deutschen Regelungen und den in ihnen enthaltenen Gerechtigkeitsvorstellungen in so starkem Widerspruch stehe, dass es nach deutscher Vorstellung untragbar erscheine. Bei der Prüfung des Verfahrens des Urteilsstaats sei ein Versagensgrund ebenfalls nur dann gegeben, wenn die Entscheidung des ausländischen Gerichts aufgrund eines Verfahrens ergangen sei, das sich von den Grundprinzipien des deutschen Verfahrensrechts in einem solchen Maß entferne, dass nach der deutschen Rechtsordnung das Urteil nicht als in einem geordneten, rechtsstaatlichen Verfahren (Art. 103 Abs. 1 GG) ergangen angesehen werden könne.
Das Beschwerdegericht habe rechtsfehlerfrei festgestellt, dass es bei der Anwendung von Art. 96 Abs. 3 CPC im Streitfall nicht um den Schutz der Rechtsordnung, sondern um konkrete Nachteile des Prozessgegners gehe. Die Zahlung solle den hohen – letztlich nicht bezifferbaren – Aufwand der Antragstellerin abgelten, der ihr dadurch entstanden sei, dass sie ungerechtfertigterweise missbräuchlich im Ausland in ein Verfahren gezogen worden sei. Eine Ersatzpflicht im Fall einer ungerechtfertigten Prozessführung sei dem deutschen Recht nicht grundsätzlich fremd. Es verstoße auch nicht gegen die deutsche öffentliche Ordnung, wenn das ausländische Recht bei feststehender Schadensersatzpflicht eine pauschale Schätzung ihrer Höhe gestatte oder mit der Verhängung von Punitive Damages nicht besonders abgegoltene oder schlecht nachweisbare wirtschaftliche Nachteile pauschal ausgeglichen oder nicht selbständig ersatzfähige Verzugsschäden abgewälzt werden sollen.
Deutschland – Zur Anwendung von nicht allgemein anerkannten Therapieformen
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass aus dem Umstand, dass ein Zahnarzt den Bereich der evidenzbasierten Medizin verlassen hat, nicht von vornherein auf einen Behandlungsfehler geschlossen werden könne. Zur Beurteilung der Frage, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, reiche ein wissenschaftliches medizinisches Gutachten nicht aus (Urteil des BGH vom 30. Mai 2017, Az.: VI ZR 203/16).
Die Klägerin hatte am 14. September 2006 einen Vortrag des beklagten Zahnarztes besucht, danach in einer Wohnung von ihm übernachtet und sich am nächsten Tag bei ihm einer von ihm sog. Herd- und Störfeldtestung unterzogen. Der Beklagte diagnostizierte ein „mehrfaches Zahnfeldgeschehen mit Abwanderungen von Eiweißverfallsgiften in den rechten Schläfen- und Kieferknochenbereich bis in den Unterleib“, ein „Kieferknochenendystrophie-Syndrom“ sowie einen „stillen Gewebsuntergang im Knochenmark“ und empfahl der Klägerin die operative Entfernung sämtlicher Backenzähne und die gründliche Ausfräsung des gesamten Kieferknochens.
Am 21. September 2006 ließ sich die Klägerin vom Beklagten operativ unter Lokalanästhesie vier Zähne im rechten Oberkiefer entfernen und den Kieferknochen in diesem Bereich „gründlich“ ausfräsen. Wegen Problemen mit dem verordneten Zahnersatz, den die Klägerin am 7. November 2006 selbst in einem Zahnlabor abholte, wandte sich die Klägerin zunächst an einen in der Nähe ihres Wohnorts tätigen Zahnarzt und am 17. November 2006 an den Beklagten. Danach brach sie die Behandlung bei ihm ab und konsultierte in der Folge verschiedene andere Zahnärzte.
Die Klägerin verklagte den Beklagten auf Rückzahlung des geleisteten Honorars in Höhe von EUR 1.187,06, Erstattung der Folgebehandlungskosten in Höhe von EUR 10.372,22, ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens EUR 5.000 und Feststellung der Einstandspflicht für sämtliche weitere Schäden. Das Landgericht Frankenthal gab der Klage weitgehend statt, kürzte jedoch den Erstattungsbetrag der Folgebehandlungskosten auf EUR 3.219,81 und sprach der Klägerin ein Schmerzensgeld von EUR 15.000 zu.
Auf die Berufung des Beklagten hin hielt das das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken das Urteil aufrecht und kürzte lediglich das Schmerzensgeld auf EUR 12.000 (Urteil vom 19. April 2016, Az.: 5 U 8/14).
Das Berufungsgericht führte aus, dass auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Klägerin die Herdsanierung, eine Außenseitermethode, ausdrücklich gewünscht habe, dem Beklagten Behandlungsfehler und mangelnde Aufklärung zur Last zu legen seien. Obwohl das lange Beschwerdebild der Klägerin zumindest nach einer psychosomatischen Mitbetreuung verlangt hätte, habe der Beklagte die chronischen Schmerzen der Klägerin nicht interdisziplinär behandelt. Vielmehr habe er das multiple Beschwerdebild der Klägerin ausgeblendet, sich rein auf die Zahnbehandlung konzentriert und ohne notwendige Gesamtabklärung auf damit völlig unsicherer Grundlage einen drastischen Eingriff bei ihr vorgenommen. Es sei nachvollziehbar, dass die wegen ihrer multiplen Beschwerden in psychisch schlechter Verfassung befindliche Klägerin davon ausgegangen sei, dass die „Radikalbehandlung“ zur Linderung ihrer Leiden unbedingt notwendig sei. Es wäre an dem Beklagten gewesen, sie darüber aufzuklären, dass vor einem solchen „Radikaleingriff“ eine interdisziplinäre Befunderhebung und entsprechende Auswertung erforderlich seien.
Auf die Revision des Beklagten hob der BGH das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zurück an das OLG Zweibrücken:
Die Anwendung von nicht allgemein anerkannten Therapieformen sei rechtlich grundsätzlich erlaubt. Schließe das Selbstbestimmungsrecht eines um die Tragweite seiner Entscheidung wissenden Patienten die Befugnis ein, jede nicht gegen die guten Sitten verstoßende Behandlungsweise zu wählen, so könne aus dem Umstand, dass der Heilbehandler den Bereich der Schulmedizin verlassen habe, nicht von vornherein auf einen Behandlungsfehler geschlossen werden.
Die Entscheidung eines Arztes für die Wahl einer nicht allgemein anerkannten Therapieform setze allerdings eine sorgfältige und gewissenhafte medizinische Abwägung von Vor- und Nachteilen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und des Wohls des konkreten Patienten voraus. Bei dieser Abwägung dürften auch die Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten der Schulmedizin nicht aus dem Blick verloren werden. Je schwerer und radikaler der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Patienten sei, desto höher seien die Anforderungen an die medizinische Vertretbarkeit der gewählten Behandlungsmethode.
Zwar habe nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die radikale Behandlungsmaßnahme des Beklagten bei der Klägerin zu schwerwiegenden, irreversiblen Gesundheitsschäden geführt (Verlust bzw. Teilverlust der Kau-, Gebiss- und Implantatfähigkeit). Die Revision rüge aber mit Recht, dass das Berufungsgericht die verantwortliche medizinische Abwägung von Vor- und Nachteilen auf der Grundlage des Gutachtens eines Sachverständigen beurteilt habe, der nicht über die erforderliche umfassende Sachkunde verfüge. Das Berufungsgericht habe es fehlerhaft unterlassen, einen auch in Theorie und Praxis mit der ganzheitlichen Zahnmedizin vertrauten Sachverständigen zu beauftragen. Auch die Frage einer hinreichenden Aufklärung der Klägerin durch den Beklagten lasse sich erst nach Einholung eines solchen Sachverständigengutachtens abschließend beantworten.
Ein Gericht kann sich zur Beurteilung der Frage, ob eine ärztliche Behandlung fehlerhaft war und zuvor eine hinreichende Aufklärung erfolgte, auf das Gutachten eines wissenschaftlichen, also mit der evidenzbasierten Medizin vertrauten Sachverständigen stützen. Im vorliegenden Fall hatte sich die Klägerin schließlich in die Behandlung eines Zahnarztes begeben und nicht in die eines Heilpraktikers oder Wunderheilers. Das Risiko eines Abweichens von wissenschaftlichen Standards durch einen Arzt kann nicht dem medizinischen Laien aufgebürdet werden.
Auch das Berufungsgericht hatte sich mit der Frage der ausreichenden Sachkunde des Sachverständigen befasst und war zu dem Schluss gekommen, dass diese gegeben sei. Vorgeworfen werde dem Beklagten schließlich nicht, seine eigene Methode (Störfeld- und Regulationstherapie) falsch angewandt zu haben, sondern vielmehr seine zuvor dargestellten Versäumnisse und Behandlungsfehler.
Der Sachverständige selbst hatte bereits im landgerichtlichen Verfahren mitgeteilt, dass er sich mit der speziellen Störfeld- und Regulationstherapie im täglichen Alltag nicht befasse und diese nur in der Theorie kenne. Aber gerade die theoretische Auseinandersetzung mit diesem komplementärmedizinischen Untersuchungs- und Therapieverfahren habe dazu geführt, dass diese Methoden aufgrund der kaum reproduzierbaren Ergebnisse zur Diagnosestellung bei ihm nicht genutzt würden.
Deutschland – OLG Hamm: Kein Schmerzensgeldanspruch der Ehefrau bei Impotenz des Ehemanns
Das Oberlandesgericht Hamm hat in einem Hinweisbeschluss gem. § 522 Abs. 2 ZPO ausgeführt, dass der Ehefrau eines Mannes, der nach einer ärztlichen Behandlung an Impotenz leidet, kein eigener Schmerzensgeldanspruch zusteht (Beschluss vom 7. Juni 2017, Az.: 3 U 42/17).
Der Ehemann der Klägerin war in den Jahren 2010 und 2011 im beklagten Krankenhaus in Herdecke mehrfach an der Wirbelsäule operiert worden. Die Klägerin behauptete, ihr Ehemann habe aufgrund der Behandlung einen Nervenschaden erlitten und sei nun impotent. Wegen dieser Beeinträchtigung ihres zuvor ausgefüllten Sexuallebens forderte sie ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens EUR 20.000.
Das Landgericht Hagen wies die Klage zurück (Urteil vom 26. Januar 2017, Az.: 4 O 339/14; nicht online abrufbar), weil es an der Verletzung eines eigenen Rechtsguts der Klägerin fehle.
Das OLG Hamm schloss sich dieser Auffassung an: Die Klägerin habe nicht vorgetragen, dass die behauptete Impotenz ihres Ehemannes bei ihr zu körperlichen oder physischen Schäden geführt hat, sondern mache lediglich einen faktischen „Verlust der Sexualität“ geltend.
Die behauptete Impotenz des Ehemannes müsse keinen vollständigen Verlust der ehelichen Sexualität bedeuten, belehrte das Gericht die Klägerin, um sich dann mit Hinweis auf den Beschluss des OLG Köln vom 22. Dezember 2015 (s. PHi-Newsletter September 2016) wieder der Rechtslage zu widmen: Der (teilweise) Verlust der ehelichen Sexualität stelle keine Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung i. S. des § 253 Abs. 2 BGB dar. Die Klägerin habe weiterhin die Möglichkeit, selbst über ihre Sexualität zu bestimmen. Dieses Recht werde durch die behauptete, rein faktische Einschränkung ihrer sexuellen Betätigungsmöglichkeiten nicht verletzt.
Die Rechtsansicht der Klägerin hätte nach Auffassung des Gerichts zur Konsequenz, dass in allen Fällen einer rechtswidrig und schuldhaft verursachten Einschränkung der Fähigkeit zur sexuellen Betätigung (z. B. bei Querschnittlähmung, Koma oder Tod infolge eines Verkehrsunfalls) grundsätzlich auch der Ehepartner des Geschädigten eigene Ansprüche geltend machen könne. Entsprechende Urteile seien dem Gericht aber nicht bekannt.
Die Klägerin nahm die Berufung am 5. Juli 2017 zurück.
Europa/Deutschland – EuG: Kein vorläufiger Rechtsschutz für BASF wegen Anordnung von Tierversuchen zu Triclosan
Der Präsident des Gerichts der Europäischen Union (EuG) hat den Antrag der deutschen BASF Grenznach GmbH (BASF) auf vorläufigen Rechtsschutz zurückgewiesen. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hatte von BASF die Vorlage von Studien zum bakterienhemmenden Wirkstoff Triclosan verlangt (Beschluss vom 13. Juli 2017, Az.: T-125/17 R).
BASF hatte Triclosan nach der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006) zum kosmetischen Gebrauch angemeldet. Die ECHA forderte mit Entscheidung vom 19. September 2014 von BASF zur Bewertung des Wirkstoffs drei Studien an:
- Simulationstests des Endabbaus im Oberflächenwasser und in Meerwasser (Persistenztest)
- Studie mit Ratten über die Entwicklungs- und Reproduktionsneurotoxizität wegen potenzieller endokriner Wirkungen (Rattentest)
- Versuch mit Zebrabärblingen oder Medakas über die sexuelle Entwicklung von Fischen (Fischtest).
Die Widerspruchskammer der ECHA bestätigte am 19. Dezember 2016 diese Entscheidung und verlängerte die Frist zur Vorlage der Studien vom 26. September 2016 auf den 26. Dezember 2018. Am 28. Februar 2017 erhob BASF hiergegen Klage vor dem EuG und stellte Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz.
BASF begründete diesen Antrag damit, dass ihr ein schwerer, nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde. Um die von der Widerspruchskammer gesetzte Frist einzuhalten, müsse BASF im vierten Quartal 2017 mit den geforderten Tierversuchen, die bereits in Vorbereitung seien, beginnen.
Wegen dieser Tierversuche laufe BASF jedoch Gefahr, gegen Art. 18 Abs. 1 der Kosmetikverordnung (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009) zu verstoßen, der Tierversuche für kosmetische Bestandteile grundsätzlich verbiete, mit der Folge nationaler Sanktionen gem. Art. 37 der Verordnung. Im Vereinigten Königreich seien sogar strafrechtliche Sanktionen zu befürchten.
Zudem laufe BASF Gefahr, den gesamten europäischen Markt für Triclosan zu verlieren, da die Kunden, die Triclosan in kosmetischen Mitteln verwendeten, diesen Wirkstoff wegen der angeordneten Tierversuche in ihren Produkten durch einen anderen ersetzen würden. Dies sei für die Kunden mit großem Aufwand verbunden und mache es unwahrscheinlich, dass sie später wieder zu Triclosan zurückkehrten.
Der Präsident des EuG wies den Antrag zurück:
Die Gefahr einer Haftung nach der Kosmetikverordnung sei rein hypothetischer Natur, da die Mitgliedstaaten keine Maßnahmen ergreifen könnten, die einer Entscheidung einer EU-Institution widersprächen, solange diese nicht von den Europäischen Gerichten für unwirksam erklärt wurde. BASF könne wegen der individuell an sie gerichteten Entscheidung der Widerspruchskammer der ECHA nicht aufgrund eines Unionsrechtsakts mit allgemeiner Geltung zur Verantwortung gezogen werden, selbst wenn die Entscheidung später für unwirksam erklärt werden sollte.
Bei dem behaupteten Verlust des europäischen Triclosan-Markts handele es sich um einen finanziellen Schaden, der allenfalls in außergewöhnlichen Situationen irreparabel sei. Die beantragte einstweilige Anordnung wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die Antragstellerin andernfalls in eine Lage geriete, die ihre finanzielle Lebensfähigkeit vor dem Ergehen der abschließenden Entscheidung im Hauptsacheverfahren bedrohen könnte, oder ihre Marktanteile (insbesondere im Hinblick auf Zuschnitt und Umsatz des Unternehmens und ggf. der Merkmale des Konzerns) wesentlich verändert würden. Hierzu habe BASF aber keinerlei Angaben gemacht.
Ausgabe von Mai 2017
Deutschland – LG Heidelberg: Berechtigte Sicherheitserwartungen bei Gesichtshaarentfernungscreme
Das Landgericht Heidelberg hat entschieden, dass eine Gesichtshaarentfernungscreme, bei der bei großflächiger Anwendung trotz erfolgreichem Vortest und Beachtung der Gebrauchshinweise die Gefahr starker Hautirritationen mit Langzeitschäden besteht, nicht den Sicherheitserwartungen der Anwender entspricht (Urt. v. 25. November 2016, Az.: 3 O 5/16).
Die Klägerin hatte am 19. Juni 2015 in einem Drogeriemarkt ein „Gesicht Haarentfernungs-Creme Set“ für EUR 7,95 erworben, dessen Herstellerin die Beklagte war. Den in der Gebrauchsanweisung verlangten Vortest führte sie durch, ohne dass negative Wirkungen erkennbar waren. Ihre Haut wies auch sonst keine Vorschäden auf. Am Folgetag gegen 18 Uhr trug die Klägerin dann eine größere Menge der Enthaarungscreme auf Wangen, Kinn und Oberlippe auf und verfuhr, wie in der Gebrauchsanweisung vorgesehen. In der Nacht entwickelte sich an den Stellen, an denen die Creme aufgetragen war, ein heftiger, blutender Ausschlag. Am nächsten Morgen rief die Klägerin in einer Hautarztpraxis an, bekam aber erst zehn Tage später einen Termin. Den ärztlichen Rat, die betroffenen Stellen sofort zu kühlen und keine Salben zu verwenden, befolgte sie. Wegen des Ausschlags verließ die Klägerin aus Scham 17 Tage lang nicht das Haus. Zurück blieben sichtbare Langzeitschäden, die eine Laserbehandlung erforderlich machten.
Die Klägerin forderte EUR 6.545,42 nebst Verzugszinsen als Schadensersatz (ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens EUR 4.000, die Erstattung der Kosten für die Laserbehandlung, EUR 144 für weitere Schadenpositionen sowie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten).
Der gerichtliche Sachverständige kam zu dem Schluss, dass die Klägerin durch die Enthaarungscreme eine irritative Reaktion der Haut und dadurch teleangiektatische Hautveränderungen erlitten hatte. Die entzündliche Reaktion hatte zu einer dauerhaften, sich nicht zurückbildenden Erweiterung kleinerer Blutgefäße und zu follikulär gebundenen Pusteln geführt.
Das Landgericht entschied, dass ein Anwender bei erfolgreichem bzw. unauffälligem Vortest mangels entsprechender weiterer Warnhinweise davon ausgehen dürfe, dass mit den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen möglichen Hautirritationen nunmehr auch bei großflächiger Anwendung nicht zu rechnen sei. Zwar dürfe ein verständiger Verbraucher keine völlige Gefahrlosigkeit erwarten. Mit Langzeitschäden wie bei der Klägerin müsse der durchschnittliche Konsument, der die Creme als kosmetisches Produkt im Gesicht und damit in einem sehr sensiblen, im menschlichen Alltag exponierten Bereich einsetze, jedoch nicht rechnen.
Gründe für einen etwaigen Ausschluss der Ersatzpflicht habe die Beklagte entgegen § 1 Abs. 4 Satz 2 ProdHaftG weder vorgetragen noch Beweis angetreten. Der bloße Hinweis, das Produkt entspreche den Anforderungen des § 4 KosmetikVO zum Schutz der Gesundheit, genüge nicht, zumal die KosmetikVO keine oder jedenfalls keine abschließende Regelung dazu enthalte, welchen Anforderungen das Produkt als solches genügen müsse bzw. welche inhaltlichen Anforderungen im Einzelnen an die Gebrauchshinweise zu stellen seien.
Das Landgericht hielt ein Schmerzensgeld in Höhe von EUR 2.000 für angemessen, da zumindest das geschminkte Gesicht der Klägerin keine besonders extremen Auffälligkeiten mehr aufweise.
Da der Sachverständige zu dem Schluss gekommen war, dass maximal fünf Gesichtsbehandlungen mit dem Laser erforderlich seien, sprach das Landgericht der Klägerin für diese fünf Sitzungen zuzüglich eines Fahrtkostenzuschlags EUR 2.000 zu sowie den Ersatz weiterer Schadenspositionen in Höhe von insgesamt EUR 144 und der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von EUR 4.045,59.
Deutschland – OLG Düsseldorf: Instruktionspflicht des Herstellers für Deckenhaken
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass das Piktogramm einer durchgestrichenen Schaukel an einem Haken hinreichend deutlich das Aufhängen eines Hängesessels an diesem Haken verbietet (Urt. v. 7. Oktober 2016, Az.: I-22 U 71/16).
Die Klägerin nahm wegen eines Sturzes mit einem Hängesessel am 30. November 2011 die Betreiberin eines Baumarkts (Beklagte zu 1) und die Zwischenhändlerin/Herstellerin (Beklagte zu 2) auf Schadensersatz in Anspruch. Sie forderte ein Schmerzensgeld in Höhe von EUR 65.000, weiteren Schadensersatz in Höhe von EUR 12.638,68 nebst Verzugszinsen sowie Feststellung weitergehender Ersatzpflicht und Freistellung von vorgerichtlichen Anwaltskosten.
Das Landgericht Düsseldorf wies die Klage mit der Begründung ab, der Deckenhaken sei nicht fehlerhaft gewesen und die Klägerin habe diesen trotz ausreichender Kennzeichnung bestimmungswidrig verwendet (Urt. v. 1. Februar 2016, Az.: 14e O 137/14).
Das OLG Düsseldorf bestätigte diese Entscheidung. Das Piktogramm einer durchgestrichenen Schaukel sei allgemein dahin zu verstehen, dass der betreffende Deckenhaken ungeeignet ist für alle Lasten, die nicht statisch wie eine Blumenampel oder ein Adventskranz, sondern dynamisch durch die Kräfte des jeweiligen Benutzers, die darauf einwirkten. Ein zusätzliches Piktogramm mit einem durchgestrichenen Hängesessel sei nicht erforderlich. Für einen objektiv verständigen Verbraucher liege es auf der Hand, dass die Belastung eines einzelnen Hakens durch 360°-Schwingungen beim Schaukeln in einem Hängesessel noch deutlich höher sei als bei der Befestigung einer Schaukel an zwei Haken, die zudem nur ein Hin- und Herschaukeln in gerader Linie ermögliche. Ferner ginge bei der Wiedergabe einer Vielzahl von möglichen Nutzungsarten auf einer Produktfahne die Warn- und Hinweisfunktion durch die fehlende Übersichtlichkeit verloren.
Soweit die Klägerin zur Begründung einer weitergehenden Instruktions- bzw. Warnpflicht auf die DIN EN 62079:2001 und den Standard ISO 3864-2 Bezug nehme, fehle es an hinreichend substanziiertem Vortrag zum Anwendungsbereich und Geltung für einen Deckenhaken. Bei DIN-Normen handele es sich nämlich nicht um Rechtsnormen, sondern um „private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter“, die den allgemeinen Regeln der Darlegungslast gem. § 138 ZPO unterfielen.
Des Weiteren sei eine Verletzung der Hinweis- bzw. Instruktionspflicht nur ursächlich, wenn pflichtgemäßes Handeln den Schaden mit Sicherheit verhindert hätte. Beweisbelastet sei hierfür gem. § 1 Abs. 4 ProdHaftG die Geschädigte. Da in der Anleitung zu dem hier verwendeten Hängesessel der Hinweis enthalten war: „Wir empfehlen einen Wirbel, z. B. Power Hook“, die Klägerin jedoch entgegen diesem Hinweis nicht einen (drehbar gelagerten) Wirbel, sondern einen (nicht drehbar gelagerten) Deckenhaken verwendet habe, hätte es zumindest weitergehenden Sachvortrags der Klägerin bedurft, warum sie zur Aufhängung des Hängesessels keinen solchen Wirbel verwendet hatte.
Das Oberlandesgericht ließ die Revision zu.
Italien – Tribunale di Ivrea: Auftreten eines Gehirntumors nach 15-jähriger intensiver beruflicher Handynutzung ist Berufskrankheit
Das Arbeitsgericht im norditalienischen Ivrea (Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro) hat einen gutartigen Gehirntumor als Berufskrankheit eingestuft, da dieser durch intensive Handynutzung verursacht worden sei (Romeo Roberto contro INAIL, Sentenza n. 96/2017 pubbl. il 30/03/2017, RG n. 452/2015)
Bei dem 57-jährigen Kläger R war 2011 ein Akustikusneurinom diagnostiziert worden. Das Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Träger der gesetzlichen Unfallversicherung in Italien, erkannte die Erkrankung nicht als Berufskrankheit an. 2013 verklagte R INAIL auf eine Rente, da ihm infolge der Tumoroperation der Hörnerv des rechten Ohrs entfernt werden musste und er daher dauerhaft zu 23 % in seiner Erwerbsfähigkeit eingeschränkt war.
Das Arbeitsgericht in Ivrea gab der Klage statt. Bei den Überlebenden der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki habe die Odds Ratio (Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen) zwischen Strahlung und Krebserkrankung bei 1,39 gelegen. Bei intensivem und längerem Gebrauch von Mobiltelefonen läge das Risiko bei 1,44. Der ehemalige Angestellte der Telecom Italia habe in den Jahren 1995 bis 2010 nach Aussagen anderer Mitarbeiter täglich zwei bis sieben Stunden per Mobiltelefon die Arbeit von mindestens 15 anderen Mitarbeitern koordiniert. Ein Headset habe er dabei nicht verwendet. Für das Gericht bestehe daher kein Zweifel am Kausalzusammenhang zwischen der abnormen Mobiltelefongebrauch im genannten Zeitraum und der Krebserkrankung des Klägers.
Die zugesprochene Rente beläuft sich auf EUR 6.000,00 bis 7.000,00 pro Jahr.
Die Entscheidungsgründe des Gerichts liegen noch nicht im Volltext vor.
Vereinigtes Königreich/England – Öffentliche Konsultation für Paradigmenwechsel bei der Entschädigung von Geburtsschäden
Das englische Gesundheitsministerium (Department of Health) hat am 2. März 2017 eine Konsultation bezüglich eines „Rapid Resolution and Redress Scheme for Severe Avoidable Birth Injury“ eröffnet. Das staatliche Entschädigungsprogramm bezieht sich ausschließlich auf Schäden im Zusammenhang mit Geburtshilfeeinrichtungen des National Health Service (NHS) in England.
Das „Rapid Resolution and Redress Scheme“ soll eine zügige Entschädigung bei vermeidbaren Geburtsschäden (insbesondere infantile Zerebralparese oder andere Hirnschädigungen) ermöglichen. Bislang legt die NHS Lititgation Authority (NHSLA) pro Jahr etwa 129 Geburtsschadenfälle mit einer durchschnittlichen Gesamtentschädigungssumme von GBP 6,25 Mio. bei. In den letzten zehn Jahren sind die Entschädigungsbeträge pro Jahr um 9 % gestiegen, was deutlich über der Inflationsrate und den allgemeinen Pflegekosten liegt.
Diese steigenden Kosten sollen durch das Programm gemindert werden. Die eingesparten Kosten sollen der Pflege der Geschädigten und der weiteren Verbesserung der Geburtshilfe zugutekommen.
Den betroffenen Familien soll die mit den langwierigen Klageverfahren verbundene Unsicherheit und Belastung erspart werden. Derzeit liegen zwischen dem Eintritt eines Geburtsschadens und der gerichtlichen Entscheidung im Durchschnitt 11,5 Jahre, weil die Art der Schädigung und der Bedarf des Kindes meist erst zum Erreichen des Einschulungsalters abschließend festgestellt werden können und oft zahlreiche Sachverständigengutachten eingeholt werden müssen. Familien mit vergleichbarem Pflegebedarf, bei denen die Schäden jedoch nicht schuldhaft verursacht wurden, erhalten zwar staatliche Leistungen, die jedoch manchmal im Umfang deutlich unter dem liegen, was nach einem Gerichtsverfahren zugesprochen wird.
Durch das Programm soll der Fokus auf „vermeidbare Schäden“ gelegt und von individuellen Schuldzuweisungen abgerückt werden. Das Etikett „schuldhafte Schädigung“ (negligence) führe dazu, dass dem einzelnen Arzt die Schuld zugewiesen werde, was die Aufrichtigkeit der Beteiligten und Möglichkeiten, aus früheren Erfahrungen zu lernen und diese Erfahrungen mit anderen Beteiligten zu teilen, beeinträchtige. Stattdessen sollen ein offenerer und transparenterer Dialog zwischen Ärzten und den betroffenen Familien erreicht (eine zeitnahe Entschuldigung eingeschlossen) und Verbesserungsmöglichkeiten auf der Systemebene ermittelt werden.
Die Teilnahme am Programm ist freiwillig – das Recht des Einzelnen zu klagen soll dadurch nicht beschnitten werden. Die Konsultation endet am 26. Mai 2017.
Ausgabe von März 2017
Deutschland – Verordnung für unbemannte Fluggeräte (Drohnen und Modellflugzeuge)
Das Bundesverkehrsministerium hat am 18. Januar 2017 eine „Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten“ vorgelegt. Künftig müssen alle unbemannten Fluggeräte (Drohnen, Modellflugzeuge) mit einem Gewicht über 250 g mit einer Plakette mit Name und Anschrift des Besitzers versehen werden.
Für den Betrieb von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen ab 2 kg ist zudem ein Kenntnisnachweis erforderlich. Dieser erfolgt durch eine gültige Pilotenlizenz oder eine Bescheinigung nach Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle (Mindestalter 16 Jahre). Für Modellflugzeuge reicht eine Bescheinigung nach Einweisung durch einen Luftsportverein (Mindestalter 14 Jahre). Die Bescheinigungen gelten für fünf Jahre. Auf Modellfluggeländen ist kein Kenntnisnachweis erforderlich.
Drohnen oder Modellflugzeuge mit einem Gewicht über 5 kg benötigen außerdem eine Aufstiegserlaubnis der Landesluftfahrtbehörden.
Für den Betrieb in Höhen von über 100 m über Grund ist eine Ausnahmeerlaubnis der Landesluftfahrtbehörden erforderlich (ausgenommen sind Modellfluggelände).
Ebenfalls grundsätzlich verboten (Ausnahmeerlaubnis möglich) ist der Betrieb von Drohnen und Modellflugzeugen
- in und über sensiblen Bereichen wie Menschenansammlungen, Industrieanlagen oder Naturschutzgebieten,
- über Flugplätzen und bestimmten Verkehrswegen,
- über Wohngrundstücken, wenn das Gerät über 250 g wiegt oder optische, akustische oder Funksignale empfangen, übertragen und aufzeichnen kann, sofern der in seinen Rechten Betroffenen dem Überflug nicht ausdrücklich zugestimmt hat,
- von Drohnen über 25 kg
- außerhalb der Sichtweite (Geräte unter 5 kg).
Als Betrieb innerhalb der Sichtweite gilt auch ein Flug mithilfe einer Videobrille bis zu einer Höhe von 30 m, sofern das Gerät nicht schwerer als 25 kg ist oder eine andere Person es ständig in Sichtweite beobachtet und in der Lage ist, den Steuerer auf Gefahren aufmerksam zu machen.
Unbemannte Fluggeräte müssen bemannten Luftfahrzeugen und unbemannten Freiballonen stets ausweichen.
Europa/Deutschland – Keine generelle Prüfungspflicht: Zur Haftung der benannten Stelle für fehlerhafte Medizinprodukte
Der EuGH hat entschieden, dass eine unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (sog. benannte Stelle) – wie der TÜV – zwar nicht generell verpflichtet ist, beim Hersteller von Medizinprodukten unangemeldete Inspektionen durchzuführen, Produkte zu prüfen und/oder Geschäftsunterlagen zu sichten. Liegen jedoch Hinweise darauf vor, dass ein Medizinprodukt die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie (RL 93/42/EWG in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 geänderten Fassung) möglicherweise nicht erfüllt, muss sie alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ihren Verpflichtungen aus dieser Richtlinie nachzukommen. Im Rahmen des Verfahrens der EG-Konformitätserklärung wird die benannte Stelle zum Schutz der Endempfänger der Medizinprodukte tätig (Urteil v. 16. Februar 2017, Rs. C-219/15).
Die Klägerin ließ sich im Dezember 2008 in Deutschland Brustimplantate einsetzen, die in Frankreich vom französischen Hersteller Poly Implant Prothèse (im Folgenden: PIP) hergestellt worden waren. Nachdem die französischen Behörden im Jahr 2010 festgestellt hatten, dass PIP die Implantate, die zu den Medizinprodukten mit der höchsten Risikoklasse (III) gehören – entgegen den geltenden Qualitätsstandards – mit angeblich „minderwertigem Industriesilikon“ herstellte, ließ sich die Klägerin auf ärztlichen Rat hin ihre Implantate im Jahr 2012 wieder entfernen.
PIP hatte die TÜV Rheinland LGA Products GmbH (im Folgenden: die Beklagte), als benannte Stelle i. S. der Medizinprodukterichtlinie mit der Bewertung (Prüfung und Überwachung) ihres Qualitätssicherungssystems beauftragt. Die Beklagte führte in diesem Rahmen u. a. zwischen 1998 und 2008 zahlreiche angekündigte Besichtigungen in der französischen Niederlassung von PIP durch. Einsicht in die Geschäftsunterlagen von PIP, wie Rechnungen und Lieferscheine, nahm die Beklagte nicht. Auch Produktprüfungen hatte die Beklagte zu keinem Zeitpunkt angeordnet.
Da PIP zwischenzeitlich insolvent war, verklagte die Klägerin die Beklagte auf Zahlung von Schmerzensgeld sowie auf Feststellung der Ersatzpflicht sämtlicher materieller und immaterieller Zukunftsschäden. Die Klägerin argumentierte, dass die Beklagte durch Einsichtnahme in die Lieferscheine und Rechnungen – wozu sie verpflichtet gewesen sei – hätte erkennen können, dass von PIP „nicht genehmigtes“ Silikon verwendet wurde.
Die Klage blieb in erster1 sowie in zweiter Instanz2 ohne Erfolg. Die Klägerin legte Revision beim BGH ein. Der BGH setzte das Verfahren aus und wandte sich mit einem Vorabentscheidungsersuchen (Art. 267 AEUV) an den EuGH3: Für die Haftung der Beklagten nach deutschem Recht sei es – so der BGH – erforderlich, dass diese gegen eine Pflicht aus dem Zertifizierungsvertrag mit PIP, in den die Klägerin als ggf. schutzwürdige Dritte einbezogen worden sein könnte, oder gegen ein Schutzgesetz (§ 823 Abs. 2 BGB i. V. mit § 6 Abs. 1 MPG) verstoßen habe. Um dies beurteilen zu können, sei von wesentlicher Bedeutung, welchen Zweck die Richtlinie 93/42/EWG mit dem Konformitätsbewertungsverfahren verfolgt, bzw. welche Pflichten der benannten Stelle in diesem Zusammenhang obliegen.
Mit seinem Urteil vom 16. Februar 2017 stellt der EuGH nunmehr fest, dass die Richtlinie 93/42/EWG dahin auszulegen ist, dass die benannte Stelle im Rahmen des Verfahrens der EG-Konformitätserklärung zum Schutz der Endempfänger der Medizinprodukte tätig wird. Die Voraussetzungen, unter denen eine benannte Stelle schuldhaft gegen eine ihr gemäß der Richtlinie obliegenden Pflichten verstoßen hat, unterliegen – so der EuGH – jedoch dem nationalen Recht. Ferner stellt der EuGH fest, dass die Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG (in concreto deren Anhang II i. V. mit Art. 11 Abs. 1 und 10, 16 Abs. 6) die benannte Stelle nicht generell verpflichten, unangemeldete Inspektionen durchzuführen, Produkte zu prüfen und/oder Geschäftsunterlagen des Herstellers zu sichten. Eine solche Pflicht bestehe allenfalls anlassbezogen. Das bedeutet für benannte Stellen: Wenn diese Hinweise erhalten, dass ein Medizinprodukt die Anforderungen der Richtlinie möglicherweise nicht erfüllt, müssen sie erforderliche Maßnahmen ergreifen, um ihren Verpflichtungen aus der Medizinprodukte-Richtlinie nachzukommen. Zu diesen (anlassbezogenen) Verpflichtungen gehört es dann u. a., dass die benannte Stelle sich davon überzeugt, dass der Hersteller die Verpflichtungen, die sich aus dem genehmigten Qualitätssicherungssystem ergeben, ordnungsgemäß einhält, und dass sie ggfs. feststellt, ob die EG- Konformitätserklärung aufrechterhalten werden kann.
Der BGH wird nun zu prüfen haben, ob die Beklagte nach deutschem Recht tatsächlich haftet, weil sie etwaige Hinweise auf eine Fehlerhaftigkeit der Implantate gehabt und ihre anlassbezogenen Prüfungspflichten verletzt haben könnte. Das darf – in Anbetracht der Feststellungen der Instanzgerichte4 – bezweifelt werden, weshalb sich die vom PIP-Skandal betroffenen Frauen im Ergebnis wohl keine großen Hoffnungen auf Schadenersatzansprüche gegen den TÜV Rheinland machen können dürften.
Ungarn – Regelungen für unbemannte Fluggeräte (Drohnen)
Auch in Ungarn sind am 31. Dezember 2016 neue gesetzliche Regelungen für den Betrieb unbemannter Fluggeräte in Kraft getreten. Diese werden weiter spezifiziert durch eine Verordnung, die voraussichtlich am 1. Juli 2017 in Kraft treten wird.
Fluggeräte mit einem Gewicht unter 250 g gelten als Spielzeug und bleiben unreguliert. Der Betrieb von unbemannten Fluggeräten bis 2 kg erfordert eine Registrierung bei der Luftfahrtbehörde, die online erfolgen kann, sowie die Teilnahme an einer Online-Schulung. Für den Betrieb von Fluggeräten bis 25 kg ist eine behördliche Genehmigung mit Nachweis der Teilnahme an einer Schulung und des Bestehens theoretischer und praktischer Prüfungen erforderlich. Fluggeräte ab 25 kg dürfen nur mit einer qualifizierten Profi-Lizenz und dem Nachweis der Lufttüchtigkeit des Fluggeräts betrieben werden.
Betreiber unbemannter Fluggeräte bis 25 kg sollen eine (freiwillige) Haftpflichtversicherung abschließen, deren Mindestversicherungssumme nach Gewicht des Fluggeräts gestaffelt ist: unter 2 kg HUF 3 Mio. (ca. EUR 9.671), 2 - 10 kg HUF 5 Mio. (ca. EUR 16.118) und über 10 kg HUF 10 Mio. (ca. EUR 32.236). Betreiber von Drohnen über 25 kg müssen für den Betrieb des Fluggeräts versichert sein und ein Logbuch über den Betrieb führen.
Unbemannte Fluggeräte dürfen nicht höher als 130 m über dem Erdboden und maximal bis zu einer Entfernung von 500 m vom Betreiber geflogen werden, der ununterbrochen und ohne Hilfsmittel Sichtkontakt zur Drohne haben muss. Die Sichtbarkeit von Fluggerät und Betreiber muss sowohl bei Tageslicht als auch im Dunkeln gewährleistet sein.
Über bestimmten Gebieten ist der Betrieb von unbemannten Fluggeräten stets verboten. Darüber und über anlassbezogene zeitlich begrenzte Sperrungen (z. B. bei Unfällen) soll eine Smartphone-App informieren. Über privaten Grundstücken dürfen Drohnen in einer Höhe von bis zu 30 m nur mit Einverständnis betrieben werden. Wohngebäude dürfen nur bis zu einer Nähe von 100 m angeflogen werden. Personen, die nicht in den Betrieb des Fluggeräts involviert sind, dürfen auf eine Entfernung von unter 30 m nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung angeflogen werden.
USA – Vergleich zwischen NFL und Footballspielern wegen neurodegenerativer Erkrankungen ist rechtskräftig
Der U.S. Supreme Court hat es am 12. Dezember 2016 abgelehnt, den zwischen der National Football League (NFL) und ehemaligen Footballspielern geschlossenen Vergleich noch einmal zu überprüfen (Scott Gilchrist, et al. v. National Football League, Raymond Armstrong, et al. v. National Football League, et al., Nos. 16-283, 16-413, U.S. Sup.). Der Vergleich ist damit am 7. Januar 2017 rechtskräftig geworden.
Am 18. April 2016 hatte der U.S. Court of Appeals for the Third Circuit in Philadelphia den Vergleich bestätigt (die PHi berichtete: PHi-Newsletter Mai 2016).
In dem Vergleich verpflichtet sich die NFL ohne ein Schuldeingeständnis, den Spielern, die berufsbedingt Gehirnerschütterungen und Stöße gegen den Kopf erlitten hatten und nun an neurodegenerativen Erkrankungen leiden, eine Entschädigung von bis zu USD 5 Mio. (je nach Symptomen, Alter und Anzahl der aktiven Jahre in der NFL) zu zahlen. Hierfür steht ein Fonds mit USD 675 Mio. zur Verfügung, der aber nicht gedeckelt ist. Für medizinisches Monitoring steht ein weiterer Fonds mit USD 75 Mio. bereit, der ebenfalls nicht gedeckelt ist. Die NFL schätzt ihre Verpflichtungen aus dem Vergleich auf maximal USD 900 Mio.
Die Kläger, die den Vergleich anfochten, wollten u. a. erreichen, dass auch Spieler, die an chronischer traumatischer Enzephalopathie (CTE) leiden (oder litten) ohne Zeitgrenze von dem Vergleich erfasst werden. Der jetzige Vergleich berücksichtigt nur Spieler, bei denen vor dem Vergleichsabschluss CTE diagnostiziert worden war. Diagnostiziert werden kann CTE erst nach dem Tod des Betroffenen; nach Ansicht des NFL sind aber die mit diesen Erkrankungen verbundenen Beschwerden wie Gedächtnisverlust und Depressionen von dem Vergleich gedeckt. Zudem enthält der Vergleich eine Klausel, wonach der Umgang mit CTE in der Vergleichsvereinbarung noch einmal von der NFL und den Spielern überprüft werden kann.
Zu dem dem Vergleich vorausgegangenen Klageverfahren und den damit verbundenen Deckungsfragen s. Midlige/Hrinewski, PHi 2014, 220 ff. u. 2015, 26 ff.
USA – Johnson & Johnson: Jury sieht keinen Zusammenhang zwischen Eierstockkrebs und talkumhaltigem Körperpuder
Eine Jury des 22nd Circuit Court, St. Louis, Missouri hat am 3. März 2017 in einer 11:1-Entscheidung überraschend entschieden, dass Johnson & Johnson und der Zulieferer Imerys keinen Schadensersatz an die an Krebs erkrankte Klägerin D zahlen müssen (Valerie Swann et al. v. Johnson & Johnson et al., No. 1422-CC09326-01, Mo. 22nd Jud. Cir St. Louis Co.).
In einer anderen Sammelklage hatte das Gericht in 2016 in drei ähnlichen Verfahren den Klägerinnen hohe Schadensersatzbeträge von insgesamt USD 197 Mio. zugesprochen (s. PHi, zuletzt: PHi-Newsletter Januar 2017).
Bei der 55-jährigen Klägerin D war 2013 Eierstockkrebs diagnostiziert worden, weswegen sie sich Gebärmutter, Eierstöcke und Eileiter entfernen lassen musste. Die Klägerin hatte nach eigener Aussage seit 1978 Talkumpuder von Johnson & Johnson im Genitalbereich benutzt. Sie vertrat die Ansicht, dass ihre Krebserkrankung durch Talkum verursacht worden war und Johnson & Johnson einen Warnhinweis auf dem Produkt hätte anbringen müssen. Sie forderte sowohl kompensatorischen Schadensersatz als auch Punitve Damages (Strafschadensersatz) in unbestimmter Höhe.
Aufgrund der von Johnson & Johnson vorgelegten Studien kam die Jury zu dem Schluss, dass die spezielle Art von Eierstockkrebs, an dem die Klägerin erkrankt war, nicht durch das Talkumpuder verursacht worden war.
Am 22nd Circuit Court, St. Louis, Missouri sind Hunderte von Klagen gegen Johnson & Johnson anhängig. Insgesamt wurden in den USA gegen Johnson & Johnson bisher ca. 2.000 Klageverfahren wegen Krebserkrankungen im Zusammenhang mit Talkumpuder eingeleitet.
USA – Ungeschützte Spielzeughersteller-Datenbank ermöglicht Zugriff auf Sprachnachrichten von Kindern
Der Spielzeughersteller Spiral Toys hat seine Kundendatenbank mit über 821.000 Einträgen ungeschützt ins Netz gestellt und auf diese Weise den Zugriff auf Sprachnachrichten von Eltern und Kindern ermöglicht, die über das Spielzeug CloudPets versendet werden können.
Bei den CloudPets handelt es sich um Plüschtiere, über die mittels einer Smartphone-App Sprachnachrichten versendet und empfangen werden können. Die Sprachnachrichten sind bei dem Filehostingdienst Amazon S3 gespeichert.
Ende Dezember 2016 wurde entdeckt, dass Spiral Toys seine Kundendaten in einer MongoDB-Datenbank gespeichert hatte, die über Shodan (eine Suchmaschine für Geräte, die mit dem Internet verbunden sind), von jedermann gefunden werden konnte. Diese Datenbank war nicht durch eine Firewall geschützt und ohne Authentifizierung (Passwort) zugänglich. Die Datenbank enthielt zudem Links zu Profilbildern der Nutzer und zu ca. 2,2 Mio. Sprachnachrichten von Eltern und Kindern.
Die Kundendaten bestanden u. a. aus einer E-Mail-Adresse und ein durch ein sicheres Verfahren verschlüsseltes und als bycrypt hash gespeichertes Passwort. CloudPets stellte jedoch keine Anforderungen an die Stärke des Passworts – sogar ein Passwort, das nur aus einem einzelnen Zeichen bestand, war erlaubt. In seinem Tutorial, in dem CloudPets zeigt, wie ein Account angelegt und ein Passwort gewählt wird, war das Beispielpasswort „qwe“. Ein zu kurzes und einfaches Passwort (weniger als 6 - 8 Zeichen, nur Buchstaben oder Zahlen, keine Sonderzeichen) kann jedoch leicht von Dritten erraten, in einen Hashwert umgewandelt und mit den in der Datenbank vorhandenen Hashwerten abgeglichen werden. Ein Test mit den beliebten Passwörtern“"qwerty“, „password“ und „123456“ sowie mit „qwe“ und „cloudpets“ ergab, dass Tausende Accounts in der CloudPets-Datenbank mit diesen extrem schwachen Passwörtern geschützt waren.
Auf diese Weise konnten sich Dritte in die betreffenden Accounts einloggen und erhielten Zugriff auf zumindest einen Teil der insgesamt mehr als 2,2 Mio. persönlichen Sprachnachrichten von Eltern und Kindern.
E-Mails an Spiral Toys und CloudPets, in denen auf die Sicherheitslücke hingewiesen wurde, blieben unbeantwortet. Auch Anrufe wurden nicht entgegengenommen. Stattdessen wurden die Daten mehrfach von unbefugten Dritten aufgerufen, anscheinend kopiert, aus der Originaldatenbank gelöscht und mit einer Lösegeldforderung versehen. Spiral Toys unterließ es, die betroffenen Eltern über den unerlaubten Zugriff zu informieren.
Kurze Zeit später stellte sich zudem heraus, dass die CloudPets-Kuscheltiere, die via Bluetooth mit einem Smartphone verbunden werden, mangels Sicherheitsvorkehrungen von jedem beliebigen Smartphone in bis zu zehn Metern Entfernung abgehört oder mit Sprachnachrichten beschickt werden können. Mit Hilfe einer Richtantenne ist dies sogar aus noch größeren Entfernungen möglich.
Zwar können die CloudPets nur fünf Nachrichten mit jeweils eine Länge von 40 Sekunden aufzeichnen. Da die Firmware jedoch weder signiert noch verschlüsselt ist, könnte diese bei Bedarf von jedermann umgeschrieben werden, um die Zeitbegrenzung zu verändern.
Endnoten
- LG Frankenthal, Urt. v. 14.3.2013 – 6 O 304/12, MPR 2013,134.
- OLG Zweibrücken, Urt. v. 30.1.2014 – 4 U 66/13, MPR 2014, 62.
- BGH, Beschluss v. 9.4.2015 – VII ZR 36/14, NJW 2015, 2737.
- Zum Instanzenzug ausführlich Lenz, PHi 2016, S. 198 - 206.
Ausgabe von Januar 2017
Deutschland – Referentenentwurf zum Schmerzensgeld für Angehörige
Das Bundesjustizministerium hat am 23. Dezember 2016 einen Referentenentwurf für die Einführung eines Hinterbliebenengelds vorgelegt. Da das Gesetz nicht der Zustimmung des Bundesrats bedarf, wird davon ausgegangen, dass es bis zum Sommer 2017 verabschiedet werden kann.
Der Entwurf weicht von dem 2015 vorgelegten Entwurf des Bayerischen Staatsministeriums (vgl. PHi 2015, 154) dahingehend ab, dass als Angehörige nicht nur Ehegatte/Lebenspartner sowie Eltern und Kinder angesehen werden, sondern der Anspruch alle Hinterbliebenen erfasst, die in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis zu der getöteten Person standen. Außerdem gilt der Anspruch auch bei Gefährdungshaftung. Identisch ist, dass der Anspruch nur bei Tötung, nicht jedoch bei schweren Verletzungen besteht.
§ 844 Abs. 3 BGB-E
Der Referentenentwurf sieht vor, dass dem § 844 BGB ein Absatz 3 angefügt wird:
„(3) Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur Zeit der Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis stand, für das dem Hinterbliebenen zugefügte seelische Leid eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Ein besonderes persönliches Näheverhältnis wird vermutet, wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war.“
Das Gesetz gilt nicht rückwirkend, sondern nur für Verletzungen, die nach seinem Inkrafttreten eingetreten sind. Es reicht also nicht aus, dass der Tod nach dem Inkrafttreten des Gesetzes eingetreten ist.
Gefährdungshaftung
Gleichlautende Absätze werden in die folgenden Gesetze eingefügt, die eine Gefährdungshaftung vorsehen:
- Arzneimittelgesetz
- Gentechnikgesetz
- Produkthaftungsgesetz
- Umwelthaftungsgesetz
- Atomgesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Haftpflichtgesetz
- Luftverkehrsgesetz
Zu berücksichtigen ist, dass ein Anspruch auf Hinterbliebenengeld aus Gefährdungshaftung auch bei gesetzlichen Verweisungen besteht, z. B. über § 177 Abs. 1 Bundesberggesetz.
Vertragliche Haftung
Kein Anspruch besteht bei vertraglicher Haftung. Ausgenommen davon sind § 618 BGB (Schutzmaßnahmen des Dienstberechtigten gegenüber Verpflichteten) und § 62 HGB (Schutzmaßnahmen des Prinzipals gegenüber Handlungsgehilfen) sowie die Passagierschadenhaftung im Luft-, See- und Schienenverkehr und Eisenbahnverkehr.
Voraussetzungen
Der Anspruch auf Hinterbliebenengeld setzt ein besonderes persönliches Näheverhältnis voraus. Vermutet wird ein solches gem. § 844 Abs. 3 Satz 2 BGB-E bei Ehegatten/Lebenspartner, Elternteil oder Kind des Getöteten. Die Vermutung kann widerlegt werden, bspw. wenn zum Zeitpunkt des Todes die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe oder die Aufhebung der Lebenspartnerschaft bestanden.
Bestand zwischen dem Getöteten und dem Hinterbliebenen eine besondere, tatsächlich gelebte soziale Beziehung, die in ihrer Intensität den in § 844 Abs. 3 Satz 2 BGB-E aufgeführten Beziehungen entsprach (z. B. nichteheliche Lebensgemeinschaft, Verlobte, Geschwister, Stief- oder Pflegekinder), so ist dies darzulegen und ggf. zu beweisen.
Das besondere persönliche Näheverhältnis indiziert, dass der Hinterbliebene infolge der Tötung seelisches Leid empfindet. Der Anspruchsgegner hat ggf. die Möglichkeit, diese Indizwirkung zu widerlegen.
Hat der Hinterbliebene einen eigenen Anspruch auf Ersatz seines Schockschadens (bspw. wegen einer medizinisch feststellbaren Gesundheitsbeeinträchtigung als Folge des Todes des Angehörigen), geht dieser dem Anspruch auf Hinterbliebenengeld vor.
Höhe
Das Gesetz sieht eine angemessene Entschädigung in Geld für das zugefügte seelische Leid vor. Die Höhe ist im Streitfall vom Gericht gem. § 287 ZPO zu schätzen. Hierbei kann die Rechtsprechung zu den Schockschäden als Orientierung dienen, wobei der Gesetzgeber darauf hinweist, dass der Anspruch auf Hinterbliebenengeld keine außergewöhnliche gesundheitliche Beeinträchtigung voraussetzt.
USA – IKEA schließt USD 50 Mio.-Vergleich nach dem Tod von drei Kleinkindern
Am 21. Dezember 2016 hat IKEA North America nach einer zweitägigen Mediation einen Vergleich mit den Familien von drei getöteten Kleinkindern geschlossen.
Die jeweils knapp zweijährigen Kleinkinder waren durch umkippende MALM-Kommoden (mit drei bzw. sechs Schubladen) ums Leben gekommen. IKEA zahlt einen Betrag von USD 50 Mio., der unter den Familien zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. Außerdem spendet IKEA jeweils USD 50.000 an Kinderkrankenhäuser in den Heimatstädten der getöteten Kinder. Zusätzlich wird IKEA USD 100.000 an die Shane's Foundation NFP spenden, die sich der Kindersicherheit, insbesondere im Hinblick auf Verhinderung des Umkippens von Möbeln widmet.
Des Weiteren versprach IKEA, in den USA künftig nur noch Kommoden zu verkaufen, die den Anforderungen des U.S. voluntary industry standard (ASTM F2057-14) für Möbel zur Kleideraufbewahrung entsprechen. IKEA wird außerdem die Finanzmittel für sein „Secure it“-Programm erhöhen, mit dem u. a. in Fernsehspots, im Internet und in den Filialen vor dem Umkipp-Risiko gewarnt wird.
IKEA hatte bereits am 28. Juni 2016 gemeinsam mit der U.S. Consumer Product Safety Commission rund 29 Mio. Kommoden in den USA und Kanada sowie später auch in China zurückgerufen (vgl. PHi 2016, 125 f.).
USA – USD 1 Mrd. Schadensersatz wegen mangelhafter künstlicher Hüftgelenke
Am 1. Dezember 2016 hat eine Jury sechs kalifornischen Klägern in einem sog. Bellwether-Verfahren (Test-Verfahren) in einer Multidistrict Litigation insgesamt mehr als USD 1 Mrd. an Schadensersatz gegen DePuy Orthopaedics, Inc. (DePuy), eine Tochter des US-amerikanischen Johnson & Johnson-Konzerns, wegen mangelhafter Hüftgelenkimplantate der Marke „Pinnacle" zugesprochen (Andrews et al v. DePuy Orthopaedics Inc et al., 3:15-cv-03484).
Bislang wurden 8.661 Klageverfahren (Stand 15. November 2016) wegen der Pinnacle-Hüftgelenkimplantate vor dem U.S. District Court for the Northern District of Texas zu einer Multidistrict-Litigation zusammengefasst (MDL 2244). Rund 1.450 weitere Verfahren sind noch in einer Multidistrict-Litigation wegen DePuys ASR-Hüftgelenkimplantaten am U.S. District Court for the Northern District of Ohio anhängig (MDL 2197), nachdem im November 2013 rund 7.000 der betreffenden Verfahren mit einem Vergleich in Höhe von USD 2,47 Mrd. beigelegt wurden (vgl. PHi-Newsletter vom 15. Januar 2014).
In beiden Fällen handelt es sich bei den Implantaten um eine Metall-auf-Metall-Konstruktion ohne Kunststoff-Beschichtung. Diese Implantate haben nicht nur eine hohe Ausfallrate, sondern produzieren auch Metallabrieb, der vom umliegenden Gewebe aufgenommen wird und zu erhöhten Chrom- und Kobaltwerten im Blut der Patienten führt. Die Patienten klagten über Schmerzen, Metallvergiftung, Gewebeschäden, Zysten, Tumore und Folgeschäden an der betroffenen Gelenkhöhle.
Die Jury in Dallas kam zu dem Schluss, dass DePuy und Johnson & Johnson die Probleme, die bei den Implantaten auftraten, verschwiegen, mit einer zu hohen Erfolgsquote warben und Ärzten in den Vereinigten Staaten finanzielle Anreize versprachen, wenn sie die Produkte ihren Kollegen empfahlen.
Es ist zu erwarten, dass DePuy gegen die jetzt ergangene Entscheidung Berufung einlegen wird. Es handelt sich um das dritte Bellwether-Verfahren in der Pinnacle-Multidistrict-Litigation. Das erste Bellwether-Verfahren wurde abgewiesen, im zweiten wurden den Klägern USD 503 Mio. zugesprochen, die nachfolgend vom Richter auf USD 100 Mio. reduziert wurden. Das vierte Bellwether-Verfahren ist für September 2017 geplant.
USA – USD 70 Mio. Schadensersatz wegen Krebserkrankung nach Gebrauch talkumhaltigen Körperpuders
Eine Jury des 22nd Circuit Court, St. Louis, Missouri, hat am 27. Oktober 2016 entschieden, dass Johnson & Johnson und der Zulieferer Imerys insgesamt USD 70 Mio. Schadensersatz an die an Krebs erkrankte Klägerin G zahlen müssen (Hogans v. Johnson & Johnson, 1422-CC09012-01).
Es handelt sich um das dritte Urteil zulasten von Johnson & Johnson und den weiteren Beklagten in einer Sammelklage, die von der Klägerin H angeführt wird. Die Klage richtet sich gegen Johnson & Johnson, Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., Imerys Talc America, Inc. f/k/a Luzenac America, Inc. und Personal Care Products Council f/k/a Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA).
Im Februar 2016 waren der Familie der im Alter von 62 Jahren verstorbenen F USD 72 Mio. und im Juli 2016 der 62-jährigen Klägerin R USD 55 Mio. zugesprochen worden (vgl. PHi-Newsletter Mai 2016).
Die 62-jährige Klägerin G aus Kalifornien hatte Johnson & Johnsons Baby-Puder über 40 Jahre im Genitalbereich benutzt. Vor drei Jahren erkrankte sie an Eierstockkrebs. Die Jury verurteilte Johnson & Johnson zu Punitive Damages in Höhe von USD 65 Mio. und 90 % des kompensatorischen Schadensersatzes (USD 2,5 Mio. an Krankheitskosten und Schmerzensgeld). Imerys wurde zu Punitive Damages von USD 2,5 Mio. verurteilt. Die Jury kam zu dem Schluss, dass Johnson & Johnson das Produkt mit einem Warnhinweis hätte versehen müssen.
Johnson & Johnson bestreitet, dass talkumhaltiger Körperpuder zu Krebserkrankungen führen kann, und wird gegen das Urteil Berufung einlegen.
Mittlerweile sind am 22nd Circuit Court, St. Louis, Missouri, Hunderte von Klagen gegen Johnson & Johnson anhängig. Weitere 300 bzw. 200 Klagen werden an bundesstaatlichen Gerichten in Los Angeles und New Jersey verhandelt. Darüber hinaus wurden 54 Klagen vor verschiedenen Bundesgerichten am 4. Oktober 2016 zu einer Multidistrict Litigation am U.S. District Court for the District of New Jersey zusammengefasst (In re: Johnson & Johnson Talcum Powder Products Marketing, Sales Practices and Products Liability Litigation, MDL 2738).
Zudem wurde angekündigt, dass 20 an Eierstockkrebs erkrankte Frauen (bzw. deren Hinterbliebene) aus der Republik Irland demnächst ebenfalls Schadensersatzklage gegen Johnson & Johnson erheben werden.
USA – USD 12,5 Mio. wegen Krebserkrankung durch mit Perfluoroctansäure kontaminiertes Trinkwasser
Eine Jury des U.S. District Court, Southern District of Ohio, hat einem an Hodenkrebs erkrankten Kläger USD 2 Mio. als kompensatorischen Schadensersatz und USD 10,5 Mio. Punitive Damages gegen den US-amerikanischen Chemiekonzern E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) zugesprochen (In re: E. I. du Pont de Nemours and Company C-8 Personal Injury Litigation, MDL 2433).
Gegen DuPont sind derzeit mehr als 3.500 Verfahren in einer Multidistrict-Litigation anhängig. Die Kläger machen Gesundheitsschäden und Todesfälle aufgrund von Trinkwasser, das mit Perfluoroctansäure (abgekürzt: PFOA oder C8) verunreinigt war, die aus dem DuPont-Washington-Werk in Parkersburg, West Virginia, stammte, geltend. PFOA wurde bis 2000 in der Teflonherstellung benutzt.
In zwei der sechs vorangegangenen Bellwether-Verfahren (Test-Verfahren) hatte das Gericht im Oktober 2015 der an Nierenkrebs erkrankten Klägerin B USD 1,6 Mio. als kompensatorischen Schadensersatz und im Juli 2016 dem an Hodenkrebs erkrankten Kläger F USD 5,1 Mio. kompensatorischen Schadensersatz und USD 500.000 Punitive Damages zugesprochen (vgl. PHi-Newsletter 2016 – September). DuPont hat gegen diese Urteile Berufung eingelegt. Drei der Bellwether-Verfahren wurden durch Vergleiche in unbekannter Höhe beigelegt. Ein weiterer Fall wurde von den Klägern aus der Gruppe der Bellwether-Verfahren zurückgezogen.
In dem nun entschiedenen ersten (Nicht-Bellwether-)Fall kam das Gericht zu dem Schluss, dass DuPont mit „actual malice" (Absicht) gehandelt habe, was die besonders hohe Punitive Damages-Summe rechtfertige.
DuPont kündigte an, auch gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.
Rechtlicher Hinweis
Alle hier enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch wird für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernommen. Insbesondere stellen diese Information keine Rechtsberatung dar und können eine solche auch nicht ersetzen.