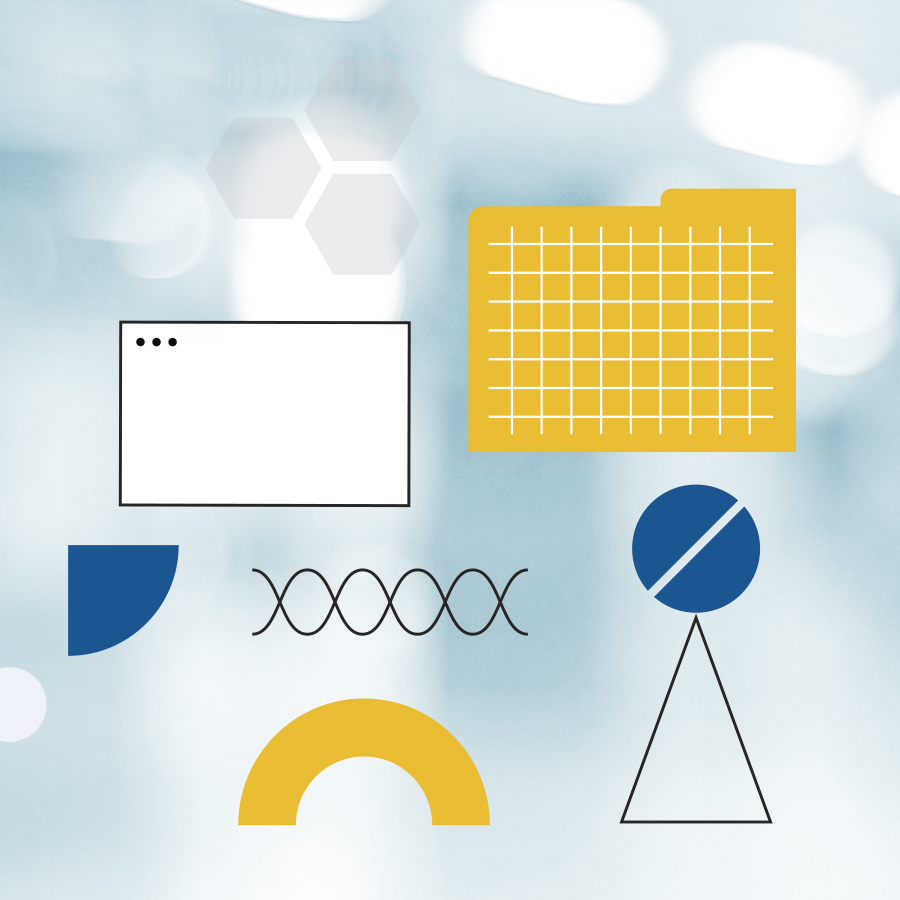-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Trending Topics
Publication
That’s a Robotaxi in Your Rear-View Mirror – What Does This Mean for Insurers?
Publication
Cat Bonds – A Threat to Traditional Reinsurance?
Publication
Decision-Making in the Age of Generative Artificial Intelligence
Publication
Buildings Made of Wood – A Challenge For Insurers?
Publication
The CrowdStrike Incident – A Wake-Up Call for Insurers?
Publication
PFAS Awareness and Concern Continues to Grow. Will the Litigation it Generates Do Likewise? -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Training & Education
Publication
How Is AI Being Used to Enhance Traditional Life Underwriting?
Publication
Understanding Physician Contracts When Underwriting Disability Insurance
Publication
Decision-Making in the Age of Generative Artificial Intelligence
Publication
Favorite Findings – Behavioral Economics and Insurance
Publication
Finding the Balance – Assessing Weight Changes in Underwriting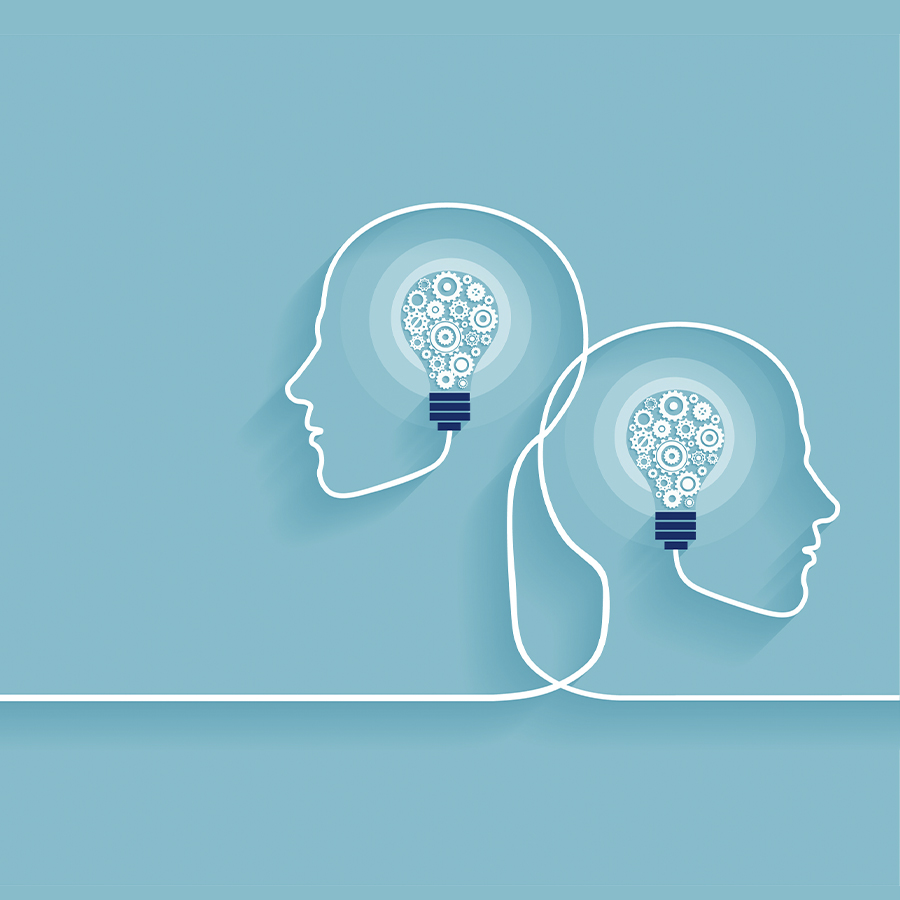 Moving The Dial On Mental Health
Moving The Dial On Mental Health -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview

Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers