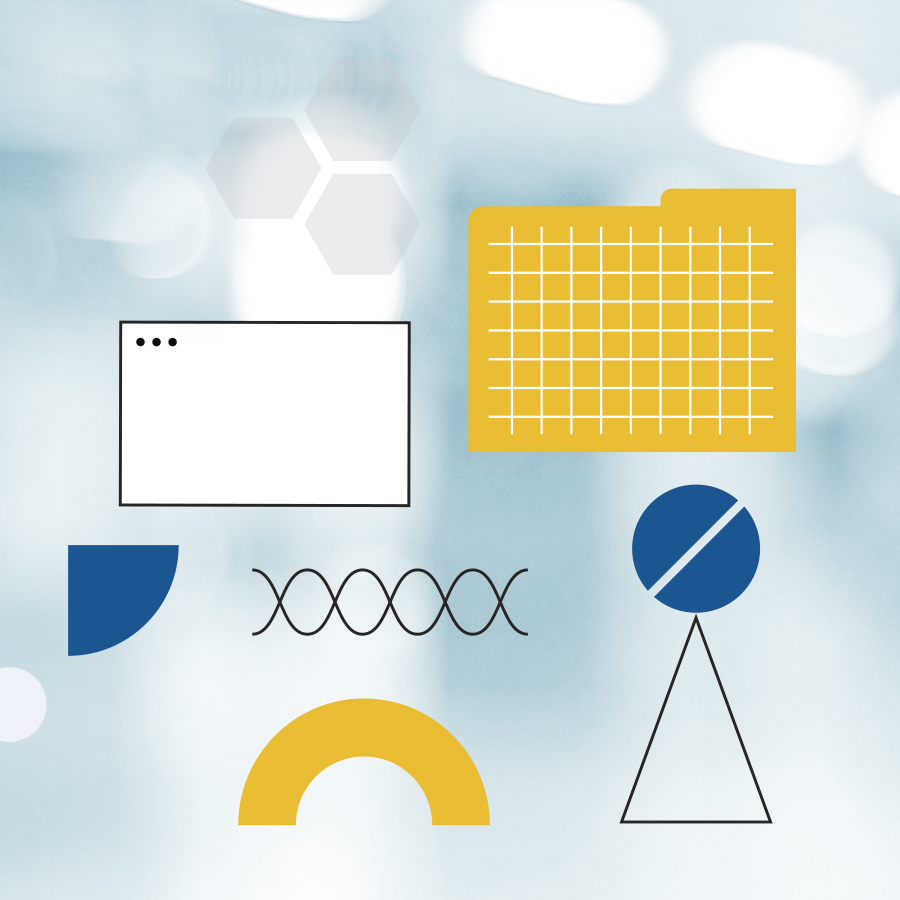-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Trending Topics
Publication
Engineered Stone – A Real Emergence of Silicosis
Publication
Use of Artificial Intelligence in Fire Protection and Property Insurance – Opportunities and Challenges
Publication
Generative Artificial Intelligence and Its Implications for Weather and Climate Risk Management in Insurance
Publication
Public Administrations’ Liability – Jurisprudential Evolution, Insurance Implications, and a Comparative Analysis Across Countries
Publication
Risk Management Review 2025
Publication
Who’s Really Behind That Lawsuit? – Claims Handling Challenges From Third-Party Litigation Funding -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Training & Education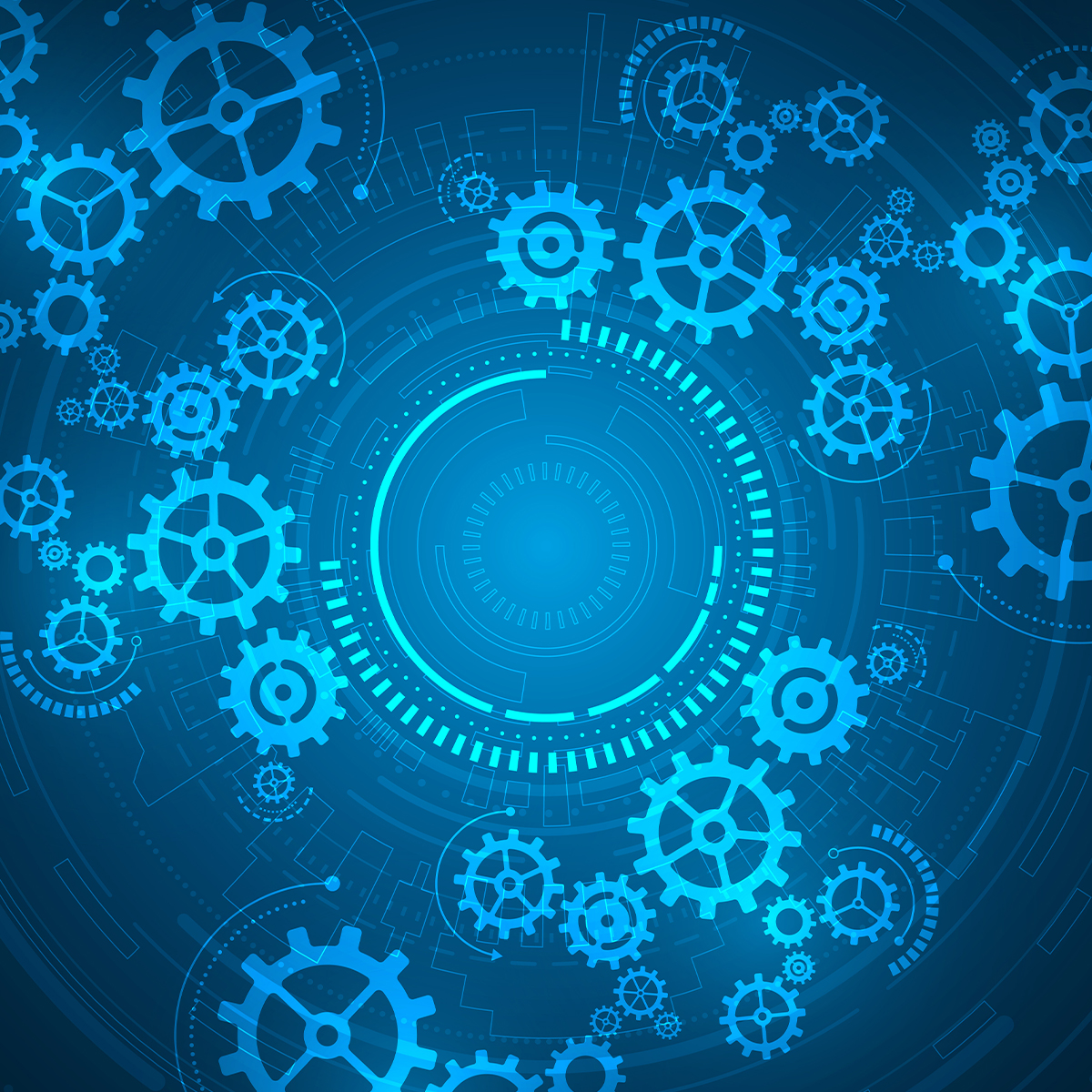
Publication
AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows
Publication
Diabetes and Critical Illness Insurance – Bridging the Protection Gap
Publication
Group Medical EOI Underwriting – Snapshot of U.S. Benchmark Survey
Publication
Why HIV Progress Matters
Publication
Dying Gracefully – Legal, Ethical, and Insurance Perspectives on Medical Assistance in Dying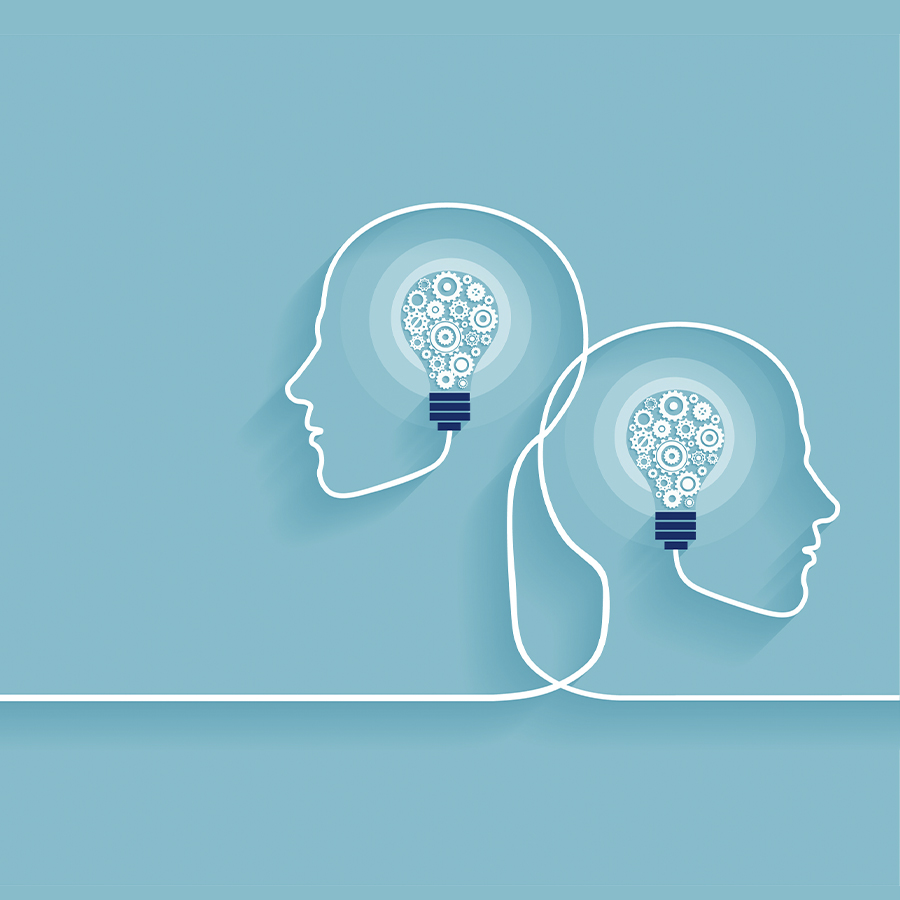 Moving The Dial On Mental Health
Moving The Dial On Mental Health -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview

Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
Wissen ist Macht? – Verwendung genetischer Informationen im Versicherungskontext

June 28, 2017
Annika Schilling
Region: Germany
Deutsch
Angesichts der rasant zunehmenden Bedeutung genetischer Tests, wie z. B. im Rahmen der Krebsdiagnostik und -therapie, und ihrer immer leichteren und kostengünstigeren Verfügbarkeit stellt sich die Frage nach ihrer Verwendbarkeit für die Zwecke der Risikoprüfung beim Abschluss einer Lebens- oder Krankenversicherung.
Die Zahl zugelassener Gentests geht heute bereits in die Tausende. Dabei ist eine Mehrzahl im klinischen Kontext anzutreffen; zunehmend häufig sind Tests jedoch auch direkt vom Verbraucher zu erwerben – typischerweise über das Internet und zu sehr überschaubaren Preisen. Es liegt nahe, dass sich all diese Tests signifikant in ihrer Qualität, Seriosität und Aussagekraft unterscheiden. Im Folgenden sollen nur solche Tests betrachtet werden, die als seriös einzustufen sind und damit im Rahmen der Risikoprüfung eine Rolle spielen könnten.
Verschiedene Arten genetischer Tests
Die wichtigste Unterscheidung im Hinblick auf genetische Tests ist diejenige zwischen diagnostischen und prädiktiven Tests.
Diagnostische genetische Tests sind vor allem darauf gerichtet, Krankheiten festzustellen. So verschafft z. B. bei einem Verdacht auf Chorea Huntington ein Gentest oft die letzte Gewissheit, ob die Erkrankung vorliegt – oder eben auch nicht. Als diagnostisch gilt gemäß § 3 Nr. 7 Gendiagnostikgesetz (GenDG) auch ein Test, der eine bereits bekannte Erkrankung näher zu bestimmen hilft. So kann z. B. bei manchen Tumorerkrankungen ein Gentest Auskunft geben, ob eine besonders aggressive Form vorliegt, die eine entsprechende Therapie erfordert. Manchmal sind diagnostische Gentests vor einer Entscheidung über die anzuwendende Therapie sogar zwingend vorgeschrieben, um lebensbedrohliche Komplikationen auszuschließen, wie z. B. vor Verwendung des Medikaments Abacavir in der Therapie der HIV-Infektion. Mit der Entwicklung der personalisierten Medizin mit stark individualisierten Therapiekonzepten gewinnen diagnostische Gentests eine immer größere Bedeutung.
Prädiktive genetische Tests sind dagegen darauf gerichtet, Krankheitsrisiken festzustellen. Sie werden z. B. durchgeführt, wenn in der Familienvorgeschichte Erkrankungen gehäuft vorkamen bzw. Erkrankungen solcher Art aufgetreten sind, die bekanntermaßen eine genetische Komponente haben, d. h. vererbbar sind. Durch eine frühzeitige Kenntnis des Risikos kann in diesen Fällen präventiv gehandelt werden; bekannteste Beispiele sind hier wohl die präventive Mastektomie und Hysterektomie bei bekannter Mutation der BRCA-Gene, die mit einem signifikant erhöhten Risiko vor allem für Brustkrebs und Eierstockkrebs einhergeht.
Zunehmend anzutreffen sind im Versicherungskontext auch solche Tests, die nur mittelbar auf die Feststellung von Erkrankungsrisiken gerichtet sind und unter dem Stichwort „Lifestyle“ vertrieben werden. Sie analysieren anhand der genetischen Information die individuellen körperlichen Gegebenheiten, z. B. im Hinblick auf die Aufnahme von Nährstoffen aus der Nahrung. Typischerweise werden Ernährungspläne und Lebensstilratgeber zur Ermöglichung einer gleichsam „genetisch optimierten“ gesünderen Lebensweise generiert. Die Ergebnisse dieser Tests werden grundsätzlich nicht dem Versicherer offenbart und eher als Marketinginstrument eingesetzt. Für die Risikoprüfung sind sie nicht als relevant anzusehen und werden daher hier auch nicht näher betrachtet.
Gesetzliche Grundlagen in Deutschland und Österreich
Die Verwendung genetischer Tests im Versicherungskontext ist in Deutschland seit 2009 durch das GenDG geregelt, das die zuvor geltende Selbstverpflichtung der Branche ablöste. § 18 Abs. 1 GenDG verbietet grundsätzlich die Entgegennahme bzw. erst recht das Verlangen genetischer Tests durch den Versicherer, erlaubt die Entgegennahme durchgeführter Tests aber wiederum für erhöhte Versicherungssummen ab 300.000 € bzw. 30.000 € Jahresrente. Die Verwendung der Erkenntnisse aus diagnostischen Tests wird mittelbar durch den Abs. 2 wieder zugelassen, da die dem Antragssteller obliegende Anzeigepflicht bzgl. Vorerkrankungen aus § 19 ff. VVG nicht eingeschränkt wird. Das heißt, der Antragsteller bleibt zur Anzeige auch solcher Vorerkrankungen verpflichtet, die mittels eines genetischen Tests diagnostiziert worden sind.
In Österreich untersagte das Gentechnikgesetz (GenTG) zeitweise jegliche Verwendung von genetischen Tests durch Versicherungsunternehmen. Nach einer Klage, die u. a. vom Verband der österreichischen Versicherungsunternehmen erhoben wurde, entschied der Verfassungsgerichtshof in 2015, dass das komplette Verbot teilweise aufzuheben sei. Seit 2017 gilt nunmehr nach § 67 Abs. 2 GenTG, dass Gentests des Typs 1 immer verwertet werden dürfen, wobei es sich bei Analysen vom Typ 1 um solche handelt, die „der Feststellung einer bestehenden Erkrankung, der Vorbereitung einer Therapie oder Kontrolle eines Therapieverlaufs“ dienen und „auf Aussagen über konkrete somatische Veränderung von Anzahl, Struktur, Sequenz oder deren konkrete chemische Modifikationen von Chromosomen, Genen oder DNA-Abschnitten“ basieren. Diese Analysen sind unabhängig von zu versichernden Summen immer zur Verwertung durch den Versicherer zugelassen, sodass die neu gefasste österreichische Regelung als für die Versicherungsbranche günstiger anzusehen ist als die deutsche.
Die Verwertung prädiktiver genetischer Tests durch Versicherer ist in beiden Ländern ausdrücklich untersagt. Aus Sicht der Versicherungsbranche besteht damit die latente Gefahr, dass Verbraucher, die mittels eines Gentests genaue Kenntnis von ihren individuellen Krankheitsrisiken erlangen, antiselektiv Versicherungsschutz einkaufen und damit die Kalkulationsmodelle der Unternehmen ins Wanken bringen könnten.
Ganz ähnlich betrachtet wird inzwischen jedenfalls in Deutschland die Verwendung familienanamnestischer Informationen. Erkrankungen in der Familienvorgeschichte können – so die Argumentation – auf eine genetische Disposition beim Antragsteller hinweisen, sodass das Wissen um solche Erkrankungen ähnliche Aussagekraft entfalten kann wie ein prädiktiver genetischer Test. Daher soll eine Verwendung derartiger Informationen wohl nur in den Grenzen des GenDG rechtlich sicher zulässig sein, d. h. jenseits der in § 18 Abs. 2 GenDG fixierten Summengrenzen. Es ist zudem eine Fragestellung zu empfehlen, die eine Identifikation einzelner Familienmitglieder unmöglich macht, um auch datenschutzrechtlichen Anforderungen sicher zu genügen.
Während international zuweilen ein sehr freier Umgang mit Angaben zur Familienanamnese praktiziert wird („Laissez-faire-Ansatz“), zielen die politischen Bemühungen auf europäischer Ebene unverkennbar in Richtung eines vollständigen Verbots.
Verwendung diagnostischer Tests in der Risikoprüfung
Für einen Großteil des Geschäfts in der Lebens- und Krankenversicherung sind aus den vorgenannten Gründen nur diagnostische genetische Tests relevant. Durch Gentest diagnostizierte Erkrankungen dürfen und sollten in der Risikoprüfung regulär Berücksichtigung finden. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für solche Informationen, die mittels Gentests bestehende Erkrankungen näher spezifizieren, wie z. B. solche zur näheren Bestimmung einer Tumorart. Fraglich kann im Einzelfall jedoch sein, ob die Information in vollständiger Detailtiefe für die versicherungsmedizinische Einschätzung im Rahmen der Risikoprüfung wirklich erforderlich und zielführend ist. Während die Individualisierung in der Therapie dem Einzelnen die größtmögliche Überlebenschance und schonendste Therapieoption ermöglicht und damit jede Anstrengung rechtfertigt, gilt es in der Versicherungsmedizin, eine angemessene Prämie mittels einer statistischen Betrachtung festzusetzen, die den Antragssteller einer Gruppe mit einer vergleichbaren Prognose zuordnet. Eine derartige Individualisierung wie im klinischen Kontext dürfte dabei oftmals weder sinnvoll noch erforderlich sein. Nicht jede genetische Information, die heute gewonnen werden kann, wird daher auch Verwendung in der Risikoprüfung finden.
Gleichzeitig steht die Versicherungsmedizin in der Lebens- und Krankenversicherung vor der Herausforderung, Prognosen über einen langen Zeitraum, oftmals Jahrzehnte, anstellen zu müssen. Die einmal in der Risikoprüfung getroffene Entscheidung kann nicht mehr adjustiert werden, wenn sich neueste medizinische Ansätze, wie z. B. neuartige Therapien, nach einiger Zeit als nicht tragfähig erweisen. Es verbietet sich also geradezu, alle neuen Entwicklungen sofort der Einschätzung zugrunde zu legen, solange noch nicht ausreichende, d. h. typischerweise mehrjährige Evidenz für ihre Relevanz vorliegt. Vieles, was im Zuge der Entwicklung der Genforschung zutage getreten ist, muss heute als noch nicht ausreichend gesichert für die Zwecke der Versicherungsmedizin angesehen werden.
Künftige Entwicklungen
Die Entwicklungen im Bereich der Gentechnik sind auch für die Risikoprüfung in der Lebens- und Krankenversicherung als enorm relevant anzusehen.
Detaillierte Kenntnisse sind gefragt, um einerseits rechtliche Risiken zu umgehen und andererseits in medizinischer Hinsicht relevante Informationen zu erkennen und ihre Aussagekraft zutreffend zu bewerten. Ein sensibler Umgang mit diesen oftmals sehr sensiblen Informationen ist oberstes Gebot.
Die Risikoprüfung steht vor einer doppelten Herausforderung: Es müssen auf der einen Seite neuartige – dem Versicherer offenbarte – Informationen sorgfältig bewertet werden. Auf der anderen Seite müssen auch die Risiken kalkuliert werden, die damit verbunden sind, dass dem Antragssteller immer mehr Informationen zur Verfügung stehen, die er dem Versicherer nicht mehr mitteilen muss.
Die nächsten Jahre werden zeigen, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf das Geschäftsmodell der Versicherer haben und ob Anpassungen erforderlich sein werden.